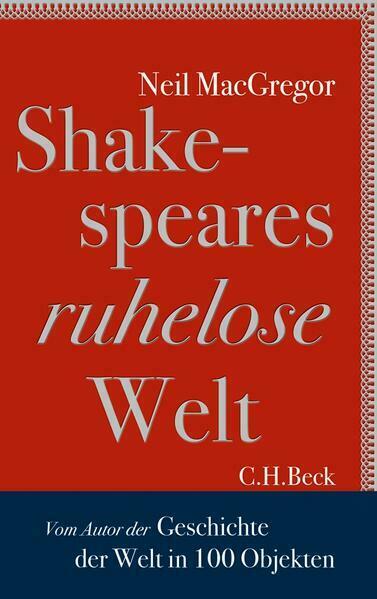Shakespeare versus Shakspere
Sigrid Löffler in FALTER 16/2016 vom 20.04.2016 (S. 28)
400 Jahre ist der größte Dramatiker aller Zeiten nun schon tot und immer noch gibt er Rätsel auf
Nicht schon wieder ein Shakespeare-Jubeljahr! Wo doch erst im April 2014 der 450. Geburtstag gefeiert wurde. Und jetzt der 400. Todestag im April 2016. Gibt’s inzwischen wirklich so viel Neues auf dem Rialto, um den Trubel zu rechtfertigen?
Natürlich nicht. Kein unbekanntes Stück (Sonett, Porträt) wurde entdeckt, die Gebeine des Gloster-Monsters Richard III. ausgenommen. Die Shakespeare-Geschäfte laufen wie immer – auf Hochtouren. Allenfalls wird der meistgespielte Dramatiker der Welt heuer noch meistergespielt, und die Schlagzahl der tagtäglich weltweit veröffentlichten wissenschaftlichen Studien zu Shakespeares Werk (nämlich fünfzehn) wird sich wohl auch noch erhöhen (die zahllosen neu erscheinenden Bücher gar nicht mitgezählt).
Mit den Shakespeare-Jubiläen verhält es sich so ähnlich wie mit den Jubelfeiern für die Queen. Beide, Will und die zweite Elisabeth, sind nicht nur nationale englische Ikonen, sie sind Weltmarken und internationale Verkaufsschlager. Ständig neue Marketingkampagnen sind da unabdingbar.
Hinter dem Label „Shakespeare“ stehen die Literaturwissenschaft, die britische Nationaldenkmalsindustrie, die Tourismusbehörde von Stratford-upon-Avon sowie die gesamte Theaterwelt – also ein mächtiges akademisches und touristisch-kulturindustrielles Imperium. Diesem wird seine Attraktivität für den Massengeschmack inzwischen auch von Hollywood bestätigt, siehe „Shakespeare in Love“. Sogar die fanatische Ketzer-Fraktion, die Shakespeare nur für den Strohmann eines ganz anderen Verfassers hält, hat sich als eigener kleiner Industriezweig etabliert und kann sich mit „Anonymus“ bereits einen massentauglichen Film gutschreiben.
„Ein ständig wachsendes Imperium benötigt einen Dichter in Übergröße“, stellte der Literaturwissenschaftler Sir Frank Kermode (1919–2010) fest, „und für diesen Job wurde Shakespeare auserkoren. Es hätte auch jemand anders sein können.“
Nein, eben nicht. Denn Shakespeare eignet sich dafür so gut wie niemand anderer, gerade weil Werk und Autor nicht glatt zur Deckung zu bringen sind. Die Diskrepanz zwischen beiden ist so offensichtlich wie rätselhaft und lässt unendlichen Raum für Mutmaßungen und Spekulationen.
Dass das größte Dramenwerk der Weltliteratur und der unscheinbare Verfasser nicht recht zusammenpassen wollen, irritiert die Welt seit Jahrhunderten. „Ein junger Mann aus einer kleinen Provinzstadt – ein Mann ohne ererbten Reichtum, der weder über einflussreiche familiäre Beziehungen verfügt, noch ein Universitätsstudium absolviert hat – siedelt gegen Ende der 1580er-Jahre nach London über und wird in bemerkenswert kurzer Zeit zum größten Dramatiker nicht nur seiner Zeit, sondern aller Zeiten. Wie lässt sich eine Leistung dieser Größenordnung erklären?“
Dies fragt sich der Harvard-Professor Stephen Greenblatt, der Herausgeber der Norton-Shakespeare-Ausgabe und Wortführer des New Historicism, der gegenwärtig einflussreichsten Denkschule der Shakespeare-Kritik. Dies fragt sich die Welt seit dem 17. Jahrhundert, als ihr die Größe und universale Bedeutung dieses Werks allmählich aufging, und erst recht seit Mitte des 19. Jahrhunderts, als der Mythos vom urwüchsigen Originalgenie – ein romantischer Erklärungsbehelf – seine Überzeugungskraft verlor.
Staunend stand und steht die Welt vor einem Textkorpus, das der Kritiker Harold Bloom so beschreibt: „Shakespeare hat in seinen Stücken mehr als hundert bedeutende Hauptfiguren und etwa tausend Nebenfiguren geschaffen – und jede von ihnen ist lebendig und unverwechselbar, spricht und handelt individuell, klingt anders und ist anders als alle anderen.“
In der Tat. Das macht Shakespeares Bühnengestalten so zeitlos faszinierend: Es sind Menschen mit einem rätselhaften und unauslotbaren Antrieb, mit dunklen Begierden und einem unsterblichen Charme. In Shakespeares Dramen findet sich alles essenziell Menschliche – außer einer glücklichen Ehe. Und gerade die Genialität des Schöpfers dieses Zauberreichs unvergesslicher Gestalten, die lebendiger sind als viele Leute, denen man im sogenannten wirklichen Leben so begegnet, musste massive Zweifel an der Urheberschaft wecken. Kann ein Abkömmling aus dem Handwerkermilieu, der Stratforder Kaufmann, Schauspieler und Theaterunternehmer William Shakspere (so unterschrieb er), Shakespeares Dramen und Gedichte wirklich selbst geschrieben haben?
Das Werk verrät einen in vielerlei Spezialkenntnissen bewanderten, weltläufigen und höfisch verfeinerten Renaissancegeist, der über einen gewaltigen Wortschatz und einen beispiellosen Erfindungsreichtum an Sprachbildern verfügte, die die englische Sprache bis heute bereichern. Zu diesem Werk wollen die ungewisse Schulbildung und das banale Leben des Sohnes eines Handschuhmachers einfach nicht passen, das sich, abgesehen vom Karriere-Abstecher nach London, auf engstem Stratforder Raum abspielte (zwischen dem Geburtshaus, dem Sterbehaus und dem Grab in der Holy Trinity Church liegt nicht einmal eine Meile).
Die Spuren, die sich von Shakespeares Leben erhalten haben, sind dürftig. Die jahrhundertelange hartnäckige Wühlarbeit ganzer Forschergenerationen in allen nur denkbaren Archiven hat nichts als bürokratischen Zettelkram zutage gefördert, und selbst diese öden Dokumente sind von Interpreten immer wieder von allen Seiten beleuchtet worden: Tauf-, Heirats- und Sterbeurkunden, Steuerrechnungen, Immobilientransaktionen, Zahlungsvermerke, eidliche Erklärungen, eine Schuldverschreibung im Zusammenhang mit einer Heiratslizenz, Personenverzeichnisse von Theaterstücken, in denen Shakespeare als Darsteller genannt wird, sowie ein allerdings sehr interessantes Testament, in dem Shakespeare seiner Tochter Susanna fast alles und seiner Ehefrau nichts als das berühmte „zweitbeste Bett“ hinterließ, seine Werke hingegen mit keinem Wort erwähnt.
Die Dokumente zeigen nicht mehr als einen nüchternen, sparsamen, hart arbeitenden Fernpendler, der als Dramatiker und Unternehmer in Londons neuester Wachstumsindustrie „Theater“ ab etwa 1590 binnen zwei Jahrzehnten jährlich zwei Stücke schrieb, zu Wohlstand kam, in London knauserte und frugal lebte, das Geld nach Hause an die Familie schickte und sein beträchtliches Vermögen in Immobilien in Stratford anlegte, wohin er sich nach seiner Theaterkarriere als biederer Rentner zurückzog.
Wir verfügen über keinerlei Briefe, Tagebücher, Manuskripte oder Notizen, nichts aus Shakespeares Hand, was ein eindeutiges Bindeglied zwischen dem Werk, dem laut Greenblatt „wichtigsten Korpus fiktionaler Literatur, das in den letzten 1000 Jahren entstanden ist“, und dem konkreten Leben lieferte oder helfen könnte, „das Geheimnis so unermesslicher kreativer Kraft zu enträtseln“.
Seit etwa 150 Jahren sieht sich das akademische Establishment daher mit immer neuen Dissidenten konfrontiert, die Shakespeares Werke anderen Autoren zuschreiben wollen. Für rechtgläubige Stratfordianer sind sie alle nur Spinner mit einem pseudo-akademischen Zeitvertreib. Die Orthodoxen wiederum müssen sich nachsagen lassen, sie seien nichts als Apologeten der boomenden Shakespeare-Industrie mit Hauptquartier in Stratford – schon deshalb müssten sie jede andere Urheber-Hypothese bekämpfen.
Um den Widerspruch zwischen Werk und Autor aufzulösen, bediente man sich bislang zweier Strategien: Entweder wurde der Autor ans Werk angepasst, oder es wurde gleich ein anderer Autor gesucht. Der ersten Denkschule zufolge mussten Shakespeares Kenntnisse und die Kreise, in denen er verkehrte, wesentlich bedeutender gewesen sein, als es den Anschein hatte.
Vor allem galt es, die kleine Lateinschule der 2000-Seelen-Marktgemeinde zu einer unwahrscheinlich bedeutenden akademischen Bildungsstätte emporzuloben. Und auch die „lost years“ in Shakespeares Biografie erwiesen sich als wahre Goldgrube für die Spekulationsgier von Lebensschatzgräbern.
Wo steckte Will in den sieben „verlorenen Jahren“ zwischen 1585 und 1592, für die alle Dokumente fehlen? Als Lehrling im Handschuhmachergeschäft des Vaters? (Das würde seine vielen Anspielungen auf die Lebens-, Sprech- und Denkweise von Handwerkern und kleinen Leuten im ländlichen Warwickshire erklären.) Als Soldat auf dem Kontinent? (Das würde seine nachweislichen Fremdsprachenkenntnisse erklären.) Als Schreiber bei einem Winkeladvokaten oder in den Londoner Inns of Court? (Das würde sein juristisches Fachwissen erklären, das sich etwa im „Kaufmann von Venedig“ zeigt.)
Neuerdings wird die Hypothese vom Geheim-Katholiken Shakespeare favorisiert, der mehrfach Rom besucht und in London als Teil einer jesuitischen Verschwörung ein Doppelleben als Krypto-Papist geführt habe.
Die gegnerische Denkschule hingegen versucht, das Werk einem anderen, plausibleren Verfasser zuzumessen. Dutzende Kandidaten für die Urheberschaft sind genannt und wieder verworfen worden, allen voran Sir Francis Bacon (zu unpoetisch), Christopher Marlowe (zu früh gestorben), Königin Elisabeth I. (zu albern).
Getippt wird zumeist auf einen Aristokraten – Shakespeare als Strohmann für einen hochgebildeten, dichtenden Kavalier am Hofe Königin Elisabeths, der sich nur unerkannt, unter Pseudonym, in der nicht standesgemäßen, volkstümlichen neuen Kreativwirtschaft des Theaters tummeln konnte.
Als heißester Kandidat gilt gegenwärtig Edward de Vere, der 17. Earl of Oxford. Der Graf, ein Mann mit großen Leidenschaften und großen Talenten, wird von den Oxfordianern derzeit als der wahre Speer-Schüttler favorisiert.
Dagegen spricht, dass De Vere eine halbe Generation älter war als Shakespeare und bereits 1604 starb, zu einem Zeitpunkt, als nach der gängigen Werkchronologie viele große Dramen – von „Othello“ und „König Lear“ bis „Macbeth“ und „Der Sturm“ – noch gar nicht geschrieben waren. Das gesamte Œuvre müsste also um mindestens ein Jahrzehnt vordatiert werden.
Seit dem Aufstieg des New Historicism in den 1980er-Jahren findet auch eine dritte Denkfigur Gehör, welche die Frage nach der Identität des Autors zu beantworten sucht, indem sie die Verfasserfigur auflöst: „Shakespeare“ als Fiktion, gleichsam als Firmen-Logo über einem gemeinschaftlich entstandenen, vergesellschafteten Text. „Seine Stücke produziert nicht ein Mann, sondern eine Gruppe, die einander zu- und zusammenspielt“, schreibt Gary Taylor, der Herausgeber der Oxforder Shakespeare-Ausgabe.
Man hätte sich „Shakespeare“ als eine Art Vereinspräsident eines Kollektivs von elisabethanischen Autoren und Diskursen vorzustellen; der Name stünde für einen ideellen Gesamtautor, in dem sich die Geistesströmungen des Elisabethanischen Zeitalters bündeln.
Im Zentrum des Interesses steht jedenfalls weniger das dokumentarisch beglaubigte Individuum Will Shakspere als vielmehr die Zirkulation sozialer Energien zwischen Politik, Theater und Religion, das Kräftespiel imperialer und kolonialer Diskurse in der Elisabethanischen Ära. Shakespeares Texte werden strikt nur im Kontext gelesen, der sie hervorbrachte – als Zeitzeugnisse, gleichwertig allen anderen elisabethanischen Dokumenten, seien es Prozessakten, Verhörprotokolle oder fromme Traktate.
Der Vorteil dieser Methode: Sie schüttelt die 400-jährige Staubfahne der Deutungen und Lesarten ab, verursacht durch eine humanistische, rein textimmanente Shakespeare-Lektüre. Der Nachteil: Eine unübersehbare ästhetische Unempfindlichkeit und ein Unvermögen zu differenzierter Textlektüre, die nicht nur Frank Kermode dem New Historicism vorwirft.
Deshalb ist Stephen Greenblatts jüngster Sündenfall so erfrischend. Ausgerechnet der Champion des New Historicism hat eine hinreißende Shakespeare-Biografie geschrieben („Will in der Welt“). Er nimmt das Werk selbst als wichtigstes Beweisstück des Lebens und zieht aus diesem Rückschlüsse auf die Biografie. Er sucht „die verbalen Spuren, die er hinterließ, in das Leben zurückzuverfolgen, das er führte“.
Das Werk als biografische Quelle zu benutzen, das galt lange als wissenschaftlich verpönt. Aber wenn sich mangels Urkunden eine biografische Brücke vom Leben zum Werk nicht schlagen lässt, muss es zulässig sein, den umgekehrten Weg zu beschreiten. Und mit seinem divinatorischen Verknüpfungstalent und seiner stupenden Detailkenntnis über den Dichter und dessen Epoche ist Stephen Greenblatt wie kein anderer befähigt, diesen Weg zu gehen. Er hilft uns, Shakespeare neu zu entdecken. Und nur ein Werk, das in jeder Generation neu entdeckt werden kann, ist wahrhaft unsterblich.
Mein lieber Schwan von Avon! Was man über Shakespeare & Shakspere alles lesen kann
Harold Bloom: Shakespeare. Die Erfindung des Menschlichen. Aus dem Amerikanischen von Peter Knecht. Berlin Verlag, 2000, 1066 S., (dzt. vergriffen bzw. nur antiquarisch erhältlich)
Der amerikanische Großkritiker und Shakespeare-Schwärmer spielt für das Laienpublikum den Reiseführer durch die Dramenwelt des Barden. Und das bedeutet: barrierefreier Zugang und Enthusiasmus pur.
Stephen Greenblatt: Will in der Welt. Wie Shakespeare zu Shakespeare wurde. Aus dem Amerikanischen von Martin Pfeiffer. Pantheon, 2015, 512 S., € 15,50
Eigentlich akademisch verpönt: Der Harvard-Professor benutzt Shakespeares Werk als biografische Quelle. Das Ergebnis: ein monumentales Spekulatorium, dirigiert von Mutmaßungen und Hypothesen, und doch glänzend imaginiert und voll brillanter Verknüpfungen.
Frank Günther: Unser Shakespeare. Einblicke in Shakespeares fremd-verwandte Zeiten. dtv Premium, 2014, 340 S., € 15,40
Eleganter und vergnüglicher Streifzug des Gesamtwerk-Übersetzers durch Shakespeares Welt. Nebstbei werden die Verschwörungstheorien der Anti-Stratfordianer spöttisch abgefertigt.
Howard Jacobson: Shylock. Der Kaufmann von Venedig. Roman. Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. Knaus, 2016, 285 S., € 20,60
Zum Jubiläum gehört eine Jubiläumsedition: Zwei Dutzend Verlage haben sich zusammengetan und acht Autoren um eine persönliche Nacherzählung eines Shakespeare-Dramas gebeten. Howard Jacobson macht den Anfang. Er macht aus der umstrittensten Shakespeare-Figur den Helden einer deftigen Burleske
Kurt Kreiler: Der Mann, der Shakespeare erfand. Edward de Vere, Earl of Oxford. Insel TB, 2011, 595 S., € 13,40
Unter den Verschwörungstheorien, die Shakespeares Werke einem anderen Autor zuschreiben, ist die De-Vere-Hypothese derzeit der heißeste Tipp. Wenn man sich auf dieses pseudo-akademische Gedankenspiel einlassen will, dann ist man bei Kreiler am besten aufgehoben: Er kann die fixe Idee der Oxfordianer am ehesten plausibel machen.
Neil MacGregor: Shakespeares ruhelose Welt. Aus dem Englischen von Klaus Binder. C.H. Beck, 2013, 347 S., € 30,80
Der Ex-Direktor des British Museum führt anhand von 20 erhaltenen Objekten mitten hinein in Shakespeares Welt – vom Helm König Heinrichs V. bis zur Wollmütze eines Handwerksburschen.
Urs Widmer: Shakespeares Königsdramen. Diogenes, 2008, 176 S., € 9,20
Mit Ironie, Witz und Chuzpe erzählt der Schweizer Autor den größten Dramenzyklus der Weltliteratur nach – Shakespeares zehn Königsdramen. Eine Mordchronik, die auch eine Mordschronik ist.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen:
Austern waren das Popcorn der Shakespeare-Zeit
Andreas Kremla in FALTER 48/2013 vom 27.11.2013 (S. 34)
Tausende Austernschalen buddelten Archäologen unter Londons Theatern aus dem 16. Jahrhundert aus. Sie waren das Popcorn der elisabethanischen Theatergeher. Die einfachen Leute naschten sie auf ihren Stehplätzen am gestampften Lehmboden. Oben auf den Rängen aßen Reich und Schön kandierte Früchte. Als echter Mann von Welt galt, wer schon die neueste Delikatesse gekostet hatte: Kartoffeln.
Shakespeare und seine Zeit – das Thema füllt einige Laufmeter Bibliotheksregale. Wie bekommt man zu dem Thema jetzt noch einmal einen taufrischen Pageturner zustande? Der Direktor des British Museum, Neil MacGregor, schafft es, indem er kleine Fundstücke aus der Theaterwelt sammelt: eine Konfektgabel, einen "magischen Spiegel" aus poliertem Obsidian, ein frivol geschmücktes Kelchglas, Landkarten oder eine grün glasierte Tonkugel mit Schlitz, genutzt als Einweg-Theaterkasse, die nach der Vorstellung zerschlagen wurde.
"Vom Charisma der Dinge bewegt unternimmt dieses Buch 20 Reisen in eine vergangene Welt", erklärt der Autor sein Vorhaben. Shakespeares Lebensspanne bestimmt den Zeitabschnitt, der hier beleuchtet wird. Sein Werk gibt die Perspektive vor: London aus der Sicht des Theaters. MacGregors erster großer Wurf "Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten" (2011) versammelte Gegenstände aus der gesamten Menschheitsgeschichte und allen Kontinenten. Dagegen erscheinen die 20 hier vorgestellten Dinge aus einer Stadt und einem Menschenleben wie das Kammerstück nach der großen Sinfonie.
Der Kunsthistoriker und Sprachwissenschaftler MacGregor beweist hier noch einmal seinen Blick für Auswahl und Komposition, kurz, für das Skurril-Signifikante, für Gebrauchsgegenstände, die den Alltag einer Zeit umreißen, auch wenn sie ein Stück außerhalb des Alltäglichen liegen. Er zeichnet ein impressionistisches Bild vom London des elisabethanischen Zeitalters – ohne Anspruch auf Vollständigkeit, dafür mit spektakulärer Ausleuchtung einzelner Details und großer Farbtiefe.