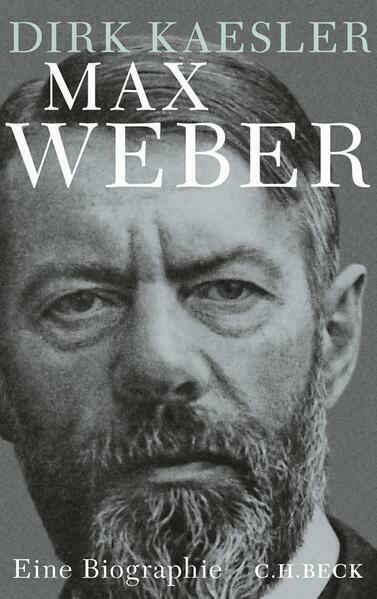Ökonomie und Macht, Bürokratie und Musik
Marianne Schreck in FALTER 11/2014 vom 12.03.2014 (S. 38)
150. Geburtstag von Max Weber: Dirk Kaesler widmet sich den familiären Hintergründen des produktiven Theoretikers
Eine tausend Seiten umfassende Biografie eines Mannes auf den Markt zu bringen, der kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges gestorben ist und politisch nicht in der ersten Reihe stand, muss wohl auf zwei Aspekte hinweisen: die herausragende gesellschaftliche Bedeutung der Persönlichkeit, gekoppelt an ein Jubiläum.
Max Webers Geburtstag jährt sich am 21. April zum 150. Mal. Soziologie, Sozialdemokratie, Bürokratie, Herrschaft, Religion und Wirtschaft – unter diesen breitgestreuten Schlagworten ist Max Weber wohl auch jenen bekannt, die aus ganz anderen Wissensgebieten kommen.
In insgesamt 13 Kapiteln widmet sich der zuletzt an der Philipps-Universität Marburg lehrende, nunmehr emeritierte Soziologe Dirk Kaesler dem Leben und Wirken des in Erfurt geborenen preußischen Universalgelehrten, der an der Schwelle des 20. Jahrhunderts stand, wo er sich mit sozial- und wirtschaftspolitischen Umbrüchen ebenso beschäftigte wie mit religiösen Aspekten, während des Krieges jedoch für dessen Fortsetzung plädierte.
Kaesler schreibt nicht das erste Mal über Max Weber. Er hat einen Teil seiner Forschung explizit diesem Mann gewidmet. Man könnte es fast selbst als ein Monumentalwerk bezeichnen, zumindest stellt es einen umfassenden Versuch dar, die sozial- und gesellschaftsgeschichtlichen Hintergründe zu rekonstruieren, auf denen Max Webers Ideen beruhen.
Mit der Absetzung der Disziplin Soziologie als Hauptfach an der Marburg'schen Universität im Jahr 2007, die Dirk Kaesler vehement bekämpfte, hat er sich aus dem akademischen Betrieb zurückgezogen, um einem der wichtigsten deutschen Vertreter der Soziologie seine Reverenz zu erweisen.
Die Themen von Webers kanonbildenden Werken, die in Soziologie und Politikwissenschaften heute noch als Basistexte herangezogen werden, erstrecken sich von der Ökonomie bis zur Macht, von der Wertfreiheit bis zur Musik.
Die Beschreibung des Verwaltungssystems (Bürokratie) für die Entwicklung moderner Gesellschaften ist zum Beispiel ein solch klassisches Theoriegebäude, ebenso die Charakterisierung der verschiedenen (historischen) Herrschaftsformen.
Der Aufbau des Buchs orientiert sich – mit Ausnahmen – an der Chronologie: Aufgrund seines umfassenden Anspruchs mäandert Kaesler jedoch immer wieder zwischen den Zeiten. Dabei überfällt einen an manchen Stellen das Gefühl, etwas bereits vernommen zu haben.
Das Buch beginnt mit Webers tragischem Tod am 14. Juni 1920 in München, wo er, bereits seit seiner Kindheit durch eine Hirnhautentzündung gesundheitlich gezeichnet, der Spanischen Grippe erliegt. Seine Frau und Weggefährtin, die Juristin und Frauenrechtsaktivistin Marianne Weber, übernimmt die Grabrede, was für eine Frau in der damaligen Gesellschaft als unschicklich galt. Die ihr gewidmeten biografische Notizen stellen wichtige und kritisch beleuchtete Koordinaten in Kaeslers Text dar.
Webers Tod bildet den Startschuss für eine Rückblende, in der detailliert auf die Geschichte und soziale Herkunft von Webers Eltern eingegangen wird. Der Weg zu Max Weber junior ist von hier an weit, was jene Leser freuen wird, die sich der Geschichte gerne biografisch nähern – und das heißt hier, mit einer Familie der gehobenen preußischen Bildungsbürgerschicht die deutsche Geschichte Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1920 zu beleuchten.
Man erfährt, dass es die familiären Kontakte der zutiefst religiösen Mutter Helene Weber sind, die dem Vater Max Weber senior als Motor für seine spätere Karriere als nationalliberaler Reichstagsabgeordneter dienen. Die aus einer wohlhabenden Frankfurter Familie kommende Helene entsprach ganz dem damaligen Frauenbild – aufopfernd und überfürsorglich. Der aus Bielefeld stammende Zweig der Familie Weber, einst reich durch den Handel mit Leinen, kann als der wirtschaftsliberale Kontext angesehen werden, der den Anstoß für Max Weber juniors ökonomische Interessen gab.
Bonmots, wonach Max Weber junior von einer Amme aus dem Arbeitermilieu genährt wurde und daher seine politischen Anschauungen mit der Muttermilch aufsog, streut Kaesler dezent und gekonnt dann zur Auflockerung ein, wenn aufgrund des fast enzyklopädischen Anspruchs der lange Atem nottut.
So verhält es sich auch mit den überschaubaren historischen Abbildungen: Sie geben einem kurz und anziehend Einblick in den Kosmos Weber, ausgiebig visuell illustriert wird sie dadurch nicht.