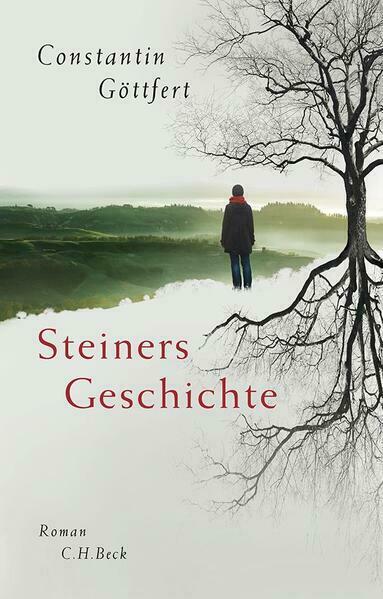Über der March endet die Welt
Juliane Fischer in FALTER 41/2014 vom 08.10.2014 (S. 10)
Wenn die Frage nach der Vergangenheit der Gegenwart die Luft abschnürt: "Steiners Geschichte" von Constantin Göttfert
Über die Provinz schreiben die Österreicher bekanntlich gerne. Zumeist nähert man sich ihr verächtlich, klischeehaft verschärft oder künstlich verklärt, was eventuell später als Ironie dargestellt werden kann. Constantin Göttfert wählt keinen dieser Wege, wenn er über das Marchfeld schreibt. Er bespielt die kahle Eintönigkeit des Dorflebens, die Stille, die seit der Kindheit des Ich-Erzählers über der March hängt, angenehm anders.
Zwischen dem Schwarz und Weiß von Antiheimat und Heimat verschafft sich sein zweiter Roman viel Platz. Dennoch vergisst er nicht auf die (dörfliche) Xenophobie, die in Österreich so allgegenwärtig ist, dass sie gar nicht mehr als solche erkannt wird. Immer wieder wird die Osterweiterung mit Metaphern einer Naturkatastrophe diskutiert, als Überschwemmung mit kriminellen Flüchtlingen beispielsweise. Nicht nur ein 10.000 Kilometer langer touristischer Radweg erinnert mit seinem Titel "Weg des Eisernen Vorhangs" noch an die ideologische, nicht zu überwindende Grenze während des Kalten Krieges.
Die Minderheit der Karpatendeutschen bildet den Mittelpunkt des Romans. Ina wurde in so eine Familie geboren. Die Nachforschungen über die Geschichte ihrer Familie, vor allem über den titelgebenden Großvater, bestimmen über ihr Leben und in weiterer Folge auch über das ihres Partners Martin. Nicht nur die Geschichten, die Inas Großmutter darüber erzählte, was man in den Geschichtsbüchern als Vertreibung bezeichnet, waren unvollständig. Auch in der Schule hatten die Lehrer auf Inas Fragen mit Unverständnis reagiert: Die Karpatendeutschen passten für sie weder zur Slowakei noch nach Deutschland und noch viel weniger zu Österreich.
Die damals neunjährige Ina war im Frühling 1990, dem Frühling nach dem Zusammenbruch der Tschechoslowakei, das erste Mal in der March schwimmen gewesen. Der Fluss spielt eine zentrale Rolle im Buch. Er markiert nicht nur eine Ländergrenze, sondern auch die Grenze zwischen Tod und Geburt. Er ist der Platz der ernsten Gespräche und Ort für Erinnerungen, nach denen man gräbt, um sie rüber in die Gegenwart zu schiffen.
Wenn Großväter damals mit ihren Enkelinnen an der March standen und sagten: "Schau, dort drüben, das ist der Kommunismus" – dann hieß das nichts anderes als: "Dort drüben ist das Ende der Welt." Hinter dem Fluss lauerte eine diffuse Bedrohung.
Die Figuren in "Steiners Geschichte" sind isolierte Geschöpfe. Jeder ist auf eine andere Art verloren. Menschen wie Martins rotlichtsüchtiger Freund hatten Osteuropa nach 1989 nur als Bordell oder Einkaufszentrum wahrgenommen; andere, wie Inas Vater, als Opfer für krumme Kreditgeschäfte und der Großteil der Bevölkerung als Kriminalitätselement.
Großvater Steiner war sein Lebtag ein zäher Mann. Er lebte als Großgrundbesitzer im slowakischen Dorf Limbach und harrte dort bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs aus. Bis zuletzt ist er auf Druck Nazideutschlands gegenüber der slowakischen Mehrheitsbevölkerung bevorzugt worden, was deren Zorn schürte. Die für ihn größte Demütigung erlebte er in Österreich, als er für andere Bauern Unkraut ausreißen musste und selbst kontrolliert wurde.
Die alte Heimat mitsamt seinem "zusammengegeizten und zusammengegaunerten" Besitz und seine Macht über die Knechte, Zwangsarbeiter und Kinder verschwanden unerreichbar hinter dem Eisernen Vorhang. Gebrochen brütet er mit seinem Schweigen über Inas Leben und dem gesamten Buch. Die fast fünfhundert Seiten sind mit Andeutungen und Unheimlichkeiten unterfüttert. Der Leser wird auf eine Geocaching-Tour durch die familiäre Vergangenheit der Steiners geschickt. Die Geschichte der Familie lässt sich gegen Ende besser fassen, restlos verständlich wird sie aber nie. Göttfert beweist den langen Atem eines Romanciers und drückt den Spannungsbogen bis zum Schluss.
Der Grundton ist trist und manchmal voll von Bernhard'schem Hass. Mit einem Schauplatzwechsel nach Limbach nimmt die Surrealität der Darstellung zu, und man fühlt sich an Kafka erinnert. Es ist, als würden den Leser die Tabletten des Protagonisten ein bisschen mitkitzeln. Das dortige Hotel wirft Fragen auf, mit Fantasie kann man es sich grotesk wie Wes Andersons Grand Budapest Hotel ausmalen.
Steiners Geschichte ist ein Roman der Grenzen, wie die March eine zwischen Österreich und der Slowakei darstellt. Wie die Grenze zwischen Verrücktheit und Zuneigung. Wie die Grenze zwischen Gegenwart und Vergangenheit.