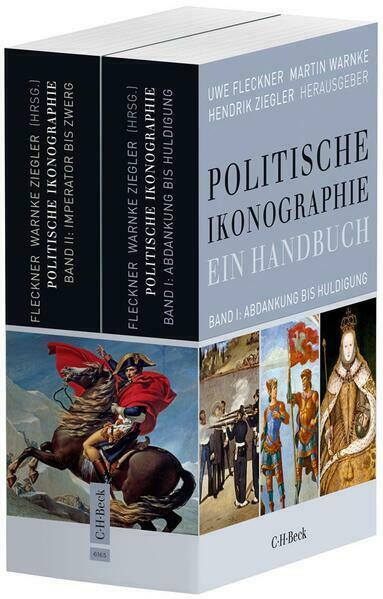Kann man ein Handbuch von A bis Z lesen?
Thomas Leitner in FALTER 41/2014 vom 08.10.2014 (S. 35)
Politische Theorie: Das zweibändige Handbuch der politischen Ikonographie liegt nun als Taschenbuch vor
Als ich vor mehr als 30 Jahren meinen Vater dabei ertappte, wie er den in Einzellieferungen einlangenden neuen Großen Brockhaus fein säuberlich von A bis Z zu lesen begann, ergoss sich Spott über diese "Bildungsbürgertümelei", und ein unausgesprochener Demenzverdacht lag in der Luft. Nun habe ich Ähnliches von mir zu vermelden.
Dasselbe ist es dennoch nicht, und das liegt weniger am über alle Selbstzweifel erhabenen kritischen Intellekt des Rezensenten als vielmehr in der Natur dieses Handbuchs über politische Ikonographie, das nun in einer günstigen Taschenbuchausgabe vorliegt. Zunächst sagt der Titel ja schon aus, dass hier keine lexikalische Vollständigkeit angestrebt wird, sondern Schlaglichter auf ausgewählte Themen dieses so weiten wie faszinierenden Feldes fallen sollen. Hier muss gesagt werden: Zumeist sind dies Glanzlichter.
Die Erneuerung und Belebung der Kunstgeschichte, die mit den ikonographischen Betrachtungen Aby Warburgs Anfang des 20. Jahrhunderts begann, zeigt sich hier auf die Beine gestellt, fortgesetzt und erweitert. Hatte es sich bei Aby Warburg, Erwin Panofsky und ihrer Schule zunächst hauptsächlich um die Rezeption antik-mythologischer und christlich-hagiographischer Thematik und deren Weiterentwicklung über die Jahrhunderte gedreht, wird jetzt eine Mannigfaltigkeit von Bildinhalten aus sämtlichen Aspekten historischer, sozialer und politischer Bereiche anvisiert.
Dabei geht es um die Intentionen der Kunstschaffenden und ihrer Auftraggeber sowie ihre Wirkung bei zeitgenössischen und nachfolgenden Rezipienten. Kunstgeschichte wird so zu einer faszinierend multidisziplinären Angelegenheit, einer Form von Kulturwissenschaft, zu der Archäologen und Historiker, Politikwissenschaftler und Philologen, Kunstphilosophen und Theoretiker der Ästhetik aus ihrem eigenen Blickwinkel beitragen.
Die so entstehende "Bildwissenschaft" gerät zu einer Lehre davon, "wie die Politik sich der Macht der Bilder bedient, um ihre Ansprüche, Hoffnungen, Erfolge und Positionen zu verkünden". Schon die Stichworteinteilung der beiden Bände – von "Abdankung" bis "Huldigung" und von "Interpretation" bis "Zwerg" – scheint mit Bedacht gewählt und beflügelt die Phantasie. Tatsächlich wird der Leser von Artikel zu Artikel (wobei man sich freilich besser an die klug angebrachten Querverweise hält, als auf altväterliche Weise von A bis Z zu lesen) in ganz unterschiedliche Wissenschaftsatmosphären eingeführt.
Hier finden sich sehr wohl auch herkömmliche kunstgeschichtliche Beiträge, die aber durch fein geschliffene Akribie bestechen. Ein besonders schönes Beispiel dafür ist etwa unter "David" zu finden. Aus der Schilderung der florentinischen Wanderwege der David-Statuen von Donatello und Michelangelo ergibt sich ein Abriss der politischen Stadtgeschichte und urbaner Geografie (Matthias Krüger).
Peter Krieger hingegen, der zunächst durch Arbeiten zu den Bildern von 9/11 und der Aktion "Desert Storm" aufgefallen war, geht von einer Ansicht der Stadtbefestigung von Avignon aus, einer heute noch eindringlichen Demonstration päpstlicher Macht. Er spannt davon ausgehend einen kunstphilosophischen Bogen, der über futuristische Metaphern der Kraft und den Lichtdom aus Flakscheinwerfern, den Albert Speer zum Nürnberger Parteitag entwarf, zu konzeptkünstlerischen Konstrukten führt. Kriegers Überlegungen enden in der Feststellung eines finalen "Formverbrauchungseffekts" (Luhmann): die Bedrohung aller künstlerischen Hervorbringungen durch die Konkurrenz der populären Bildproduktion in Massenmedien und Cyberworld.
Und ist man dann wirklich beim "Zwerg" angelangt, findet man als krönenden Abschluss einen geradezu vergnüglichen Beitrag von Lothar Sickel. Zeugt die Darstellung von kleinwüchsigen "Narren", wie wir sie aus dem spanischen Goldenen Zeitalter v.a. von Velázquez und Murillo kennen, noch von einem heute makaber wirkenden Voyeurismus dieser "Laune der Natur" gegenüber, setzt im England des 17. Jahrhunderts eine gewisse Emanzipation ein. Eindrucksvoll, wie selbstbewusst Richard Gibson aus der letzten Abbildung des Buches auf uns blickt: Er hatte seine Karriere noch als Hofnarr begonnen, es aber bis zum königlichen Hofmaler gebracht – und malte übrigens hauptsächlich Miniaturen.
Die Illustrationen der beiden Bände sind schwarz-weiß und, was eher stört, recht kleinformatig. Allerdings: Vor die Wahl gestellt, einen unhandlichen Wälzer zu produzieren, beim Umfang des Textes zu sparen oder zur Reduktion des Formates zu greifen, scheint die Entscheidung plausibel. Und: Heutzutage lässt sich (fast) jedes Bild ohne langwierige Recherche aus dem Internet fischen – das übrigens auch dazu dienen kann, sich Informationen zu den Autoren zu verschaffen, die das Handbuch leider vorenthält. Zumindest aus welchem Wissenschaftszweig sie kommen, hätte man schon wissen wollen.
Symptome der Demenz stellen sich jedenfalls auch nach ausgiebigem Gebrauch des Kompendiums nicht ein, und zur Bildungshuberei ist die Lektüre ebenfalls schwer zu missbrauchen. Vielmehr schärft sie die Wahrnehmung allen Phänomenen der Kunst gegenüber und, was noch wichtiger ist: Sie führt zu einem kritischeren Blick auf den "Krieg der Bilder", die Zurichtung der Wirklichkeit(en) durch die Medien unserer Zeit. Martin Warnke, dem langjährigen Leiter des Warburg-Hauses in Hamburg, glückt so eine großartige Erweiterung seines Bildatlasprojekts. Gemeinsam mit seinem Nachfolger Uwe Fleckner und Hendrik Ziegler sowie dem Autorenteam hat er antike Götter auf den Boden der heutigen Realität geholt.