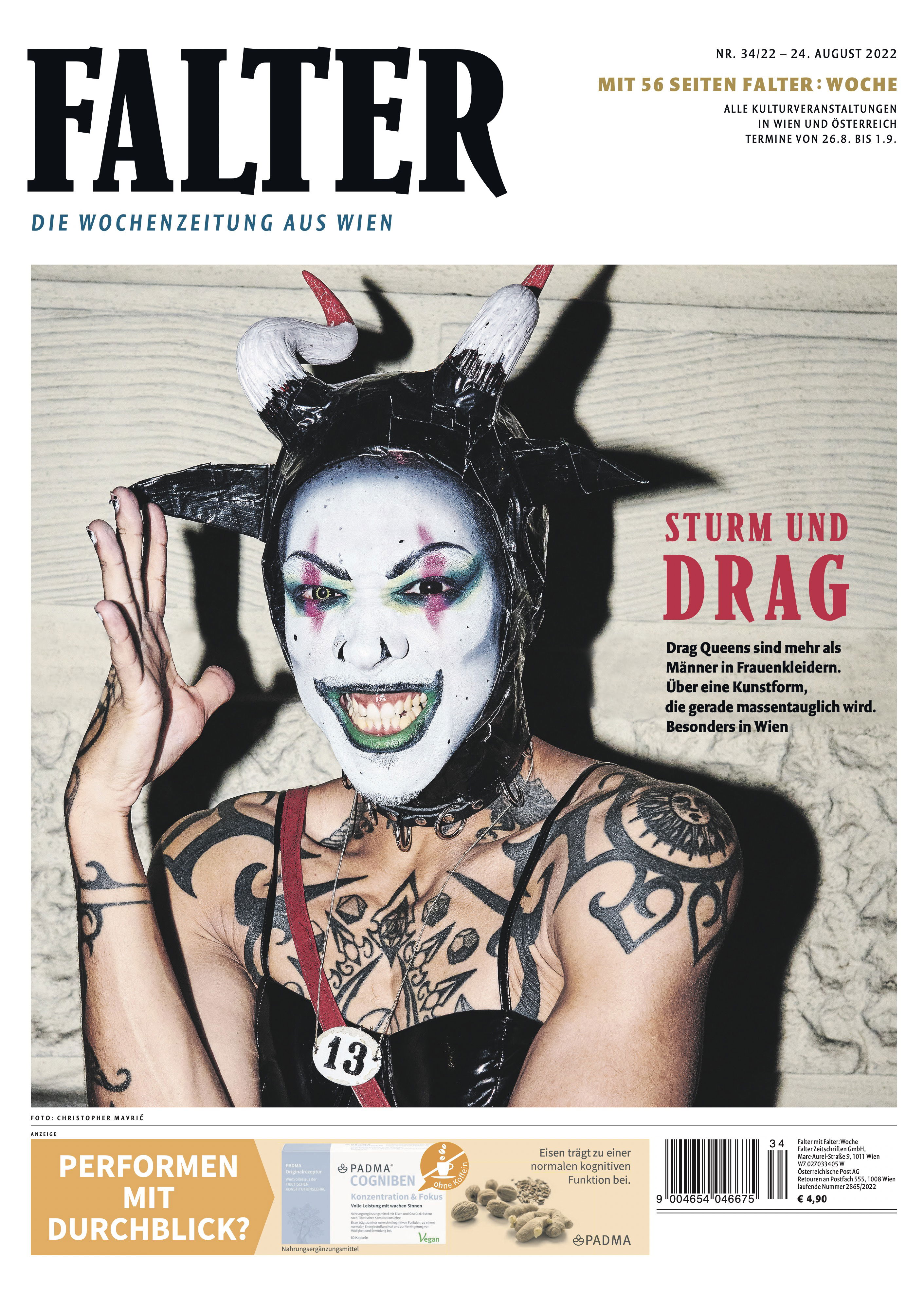
Markus Marterbauer in FALTER 34/2022 vom 24.08.2022 (S. 22)
Der Erfolg von Thomas Pikettys "Kapital im 21. Jahrhundert" wurde zum Ausgangspunkt einer "Piketty-Schule der Ökonomie" und der World Inequality Database (WID), der umfassendsten Sammlung von Daten zur Verteilung von Einkommen und Vermögen. Er beschreibt die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, als das reichste Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des Vermögens besaß und nur durch Erbschaft und Heirat reich werden konnte. Die im Buch dargestellte Formel r > g zierte sogar T-Shirts: Die Rendite auf Vermögen ist größer als das Wachstum der Wirtschaft, die Vermögenskonzentration verstärkt sich. Piketty bietet Abhilfe: progressive Steuern auf Erbschaften und Vermögen.
Die Gmachls und die Mirkovics
Judith E. Innerhofer in FALTER 47/2014 vom 19.11.2014 (S. 10)
Zwei Familien in Österreich. Beide arbeiten hart. Trotzdem kann nur eine der beiden sparen und vererben. Warum? Eine Geschichte über Chancen
Ganz gerecht wird es wohl nie werden. Aber es ist heute schon wesentlich gerechter als früher", sagt Friedrich Gmachl, Seniorchef eines stattlichen Familienunternehmens im Salzburger Elixhausen, und denkt dabei an die Knechte und Mägde, die einst im Alter ohne jede Versorgung gezwungen waren, nachts von Hof zu Hof um Unterschlupf anzuklopfen. Heute sei es auch nicht mehr so entscheidend, wie viel jemand verdiene. "Du kannst noch so viel verdienen, wenn du es ausgibst, dann hast du nichts. Aber wenn die Leute sparen können, dann bringen sie was zusammen."
"Sparen", sagt Amela Mirkovic, "hat leider nichts gebracht." Etwa damals, als die alleinerziehende Wienerin mit 5.500 Schilling Karenzgeld vier Personen durchbringen musste. Trotz Studium hat die Tochter eines Gastarbeiterpaares den finanziellen Aufstieg nicht geschafft. Und das habe auch etwas mit dem System zu tun: "Warum zahlen wir den Menschen, denen wir unser Geld anvertrauen, viel mehr als jenen, denen wir unsere Kinder anvertrauen? Das zeigt doch schon, wie man bei uns Vermögen machen kann."
Friedrich Gmachl und Amela Mirkovic: zwei Lebensentwürfe, zwei Perspektiven auf die Gesellschaft, ebenso unterschiedlich wie typisch österreichisch. Friedrich Gmachl, der einen altangestammten Familienbesitz tatkräftig und mit viel schlauer Antizipation zu einem florierenden Vorzeigeunternehmen ausgebaut hat. Superior-Hotel, Gourmetrestaurant, zweites Gasthaus, Metzgerei, Reitbetrieb, Viehzucht, Landwirtschaft, Tennisanlagen, Fußballplätze, und für das Privatleben seit einigen Jahren die moderne Villa über dem Dorf. Auf der anderen Seite Amela Mirkovic am Küchentisch der Zwei-Zimmer-Mietwohnung, mit Möbeln aus zweiter Hand und einem Händchen fürs Schöne, ebenso einfach wie heimelig.
Mit der grobschlächtigen Unterschicht aus abstoßenden Fernsehformaten hat Amela Mirkovic ebenso wenig gemein wie der Großteil der weniger Privilegierten in Österreich. Mehr als 1,5 Millionen Menschen und damit jeder fünfte Österreicher ist im zweitreichsten Land Europas von Armut und Ausgrenzung gefährdet. Unter den Alleinerziehenden sind es sogar 41 Prozent. Wie viele von ihnen hat auch Amela Mirkovic, die vom Kindesvater keinerlei Alimente bekam, zwar immer gearbeitet, oft weit unter ihren Qualifikationen als Akademikerin. Kinderbetreuung, Miete, Essen. Schulausgaben, Zahnarzt oder passende Schuhe für wachsende Kinder. Sparen reicht nicht, wenn der Lohn nicht reicht.
500.000 Österreicher sind trotz Arbeit arm. Und es werden immer mehr. 1976 teilten sich die 20 Prozent der Bestverdiener rund 40 Prozent des gesamten Lohneinkommens, die ärmsten 20 Prozent mussten sich mit 4,8 Prozent begnügen. Mittlerweile ist der Anteil der Ärmsten weiter drastisch geschrumpft, auf nur mehr 1,9 Prozent. Und das Fünftel der Topverdiener kassiert schon fast die Hälfte aller Einkommen. Bei Fortschreibung des Trends erwartet die OECD, dass die Lohnverteilung in Österreich im Jahr 2060 so ungleich sein wird wie in den USA.
"Und das ist auf Dauer gesehen tatsächlich ein Zündstoff auch für soziale Unruhen." Der Philosoph Clemens Sedmak blickt auf den ihm persönlich gewidmeten Honoratiorenstuhl in den altehrwürdigen Professorenreihen des Londoner King's College und verkörpert eigentlich das Musterbeispiel für Erfolg durch Leistung: Mit 23 Jahren promovierte der gebürtige Oberösterreicher sub auspiciis, zwei Jahre später trug er bereits drei Doktortitel, wurde als erst 30-Jähriger im Jahr 2000 als jüngster Universitätsprofessor Österreichs an die Universität Salzburg berufen und vier Jahre später an das renommierte britische College geholt. Dennoch: "Man versucht sich sehr schnell eine Lebenslüge zusammenzuzimmern, die besagt: Ich bin aufgrund meines Verdiensts irgendwohin gekommen. Und möge das eine Rolle gespielt haben: Es gehört sehr viel mehr dazu als bloßes Verdienst. Beginnend mit der Frage: Wieso hast du überhaupt eine höhere Schule besuchen, wieso hast du studieren können?"
Startbedingungen und Lebenschancen, Armut und Wohlstand: Die Themen, mit denen sich Sedmak beschäftigt, haben Hochkonjunktur. Nicht erst seit Thomas Pikettys Bestseller ist die Verteilungsdebatte in der öffentlichen Wahrnehmung präsent, global ebenso wie im europäischen Wohlstandsgebiet. "Wir kehren zurück zu einer Anhäufung von Reichtum wie im 19. Jahrhundert. Die Konzentration von Vermögen ist extrem hoch, das Einkommen kommt aus Mieten und Erbschaft. Wir belohnen nicht Leistung und Verdienst, wir belohnen vererbten Reichtum", sagt auch Sir Michael Marmot, der britische Wissenschaftler.
Weil der Anteil der Reichsten ebenso wächst wie langfristig die Zahl der Armutsgefährdeten, schrumpft die vielbeschworene Mitte in Österreich, das zu den drei OECD-Ländern mit der höchsten Steuer- und Abgabenbelastung für einen Durchschnittsverdiener gehört. Seit 1992 ist die Lohnsteuer um 138,8 Prozent gestiegen. Fast gar nicht besteuert werden hierzulande hingegen Vermögen: Die eigentliche Vermögenssteuer auf Besitz wurde schon 1993 abgeschafft. Und seit 2008 gibt es auch keine Erbschafts- und Schenkungssteuer mehr.
Im idyllischen Dorfimperium von Elixhausen zwischen Zwiebelkirchturm, Kanapees und Wellnessanlage musste sich Seniorchef Friedrich Gmachl noch eine andere Frage stellen: Wie teilt man ein Erbe gerecht auf? "Bei uns am Land sagt man ja so: Der, der den Hof bekommt, bekommt die Kuh, und die anderen müssen sich den Schwanz teilen." Den größten Teil des Unternehmens hat Gmachl schon mit Mitte 50 an seine älteste Tochter weitergegeben, nunmehr die 23. Generation am Ruder des Gmachl-Universums. Der zweiten Tochter, die sich wenig für die Gastronomie interessierte, finanzierte der Vater eine Tierarztpraxis. Und die jüngste, Tini Gmachl, hatte klare Vorstellungen: "Ich bin vor einem Jahr 30 geworden und habe gesagt, dass ich gerne ein Stadthotel hätte mit mindestens 30 Zimmern", erzählt Tini Gmachl. Gesucht, gefunden, "per Handschlag gleich gekauft, und seit 1. Jänner 2014 habe ich dieses Haus. Damit ist für mich ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen." Neider gebe es freilich immer, sagt Tini Gmachl. "Aber ich war nie arbeitsscheu. Ich habe immer für mein Geld gearbeitet. Somit komme ich mir auch nicht gegenüber anderen bevorzugt vor. Das Glück ist einmal hier und einmal da, somit denke ich mir nichts dabei."
Amela Mirkovics Kinder haben dieses Glück nicht. "Jetzt sind wir schon die vierte Generation in unserer Familie, die ihren Lebensstart ohne irgendeine Unterstützung und ohne Ressourcen beginnen muss, ohne 20.000 Euro für die Erstwohnung oder Ähnliches. Meine Kinder starten auch mit null ins Leben. Das hätte ich mir anders vorgestellt."
"Ich beobachte mit großer Sorge, dass immer mehr Menschen nicht mehr von ihrer Arbeit und zugleich immer mehr Menschen von Vermögen leben können", sagt Clemens Sedmak. 1,25 Billionen Euro beträgt der gemeinsame Wert von Immobilien, Grundbesitz und verschiedensten Geldanlagen im Land. Fast zwei Drittel davon gehört einer Minderheit von fünf Prozent der Österreicher. Die "ärmsten" 50 Prozent im Land teilen sich gerade einmal 2,2 Prozent des Kuchens. Ein Prozent der österreichischen Haushalte verfügt in Summe über deutlich mehr Reichtum als die unteren 90 Prozent zusammen. Mit jeder Stunde wird die Kluft größer, rechnet die Arbeiterkammer vor: Das Vermögen der reichsten zehn Prozent wächst jede Stunde um 3,2 Millionen Euro, fast dreimal so schnell wie jenes der restlichen 90 Prozent der Bevölkerung.
Und Vermögen wird hauptsächlich an jene vererbt, die schon besitzen: Von den ärmsten zehn Prozent der Österreicher erbt nur jeder Zehnte – durchschnittlich knapp 16.000 Euro. Von den reichsten zehn Prozent erben rund zwei Drittel, pro Kopf im Schnitt 312.900 Euro – steuerfrei.
"Man kann Armutsbekämpfung nicht ohne Privilegienabbau leisten. Das wird nicht funktionieren, aus dem einfachen Grund, weil der Kuchen nicht größer werden wird, sagt uns die Wirtschaftsforschung. Wenn ich Menschen, die benachteiligt sind, helfen möchte, muss ich anderen etwas wegnehmen", sagt Armutsforscher Sedmak. "Ich halte es für gefährlich, einfach zuzusehen, wie die Schere zwischen arm und reich, zwischen reich und sehr reich und die Schere zwischen sehr reich und extrem reich immer größer wird. Das ist für ein Gemeinwesen nicht gut. Natürlich hätte der Staat hier als Fiskalautorität Instrumente, um gegenzusteuern."
Die Debatte über die Steuerreform lässt kaum Hoffnung, dass sich die Ungleichheit verringern wird. Denn die Änderung der Steuersätze wird nur jenen mehr Geld bringen, die ohnehin relativ gutgestellt sind. Und angesichts der Tatsache, dass bereits 1,1 Millionen Österreicher nicht mehr das ganze Jahr durchgehend Arbeit haben, wird auch die Reduzierung des Einstiegssteuersatzes jenen, die zu wenig zum Leben haben, kaum etwas bringen. Auch der zweite Hebel, mit dem Ungleichheit verändert werden kann, ist in Österreich seit Jahrzehnten verrostet. "Man versucht den Kindern zwar zu vermitteln: Lern was, dann wirst du was. Wenn du nur fleißig bist, kannst du aufsteigen. Aber das stimmt nicht", hält nicht nur Clemens Sedmak die vielbeschworene Leistungsgerechtigkeit für Hohn.
OECD und zahllose Wissenschaftler analysieren Jahr für Jahr, dass Österreichs geteiltes Schulsystem sozialen Aufstieg fast komplett verhindert. Kinder von Akademikern erreichen zu mehr als der Hälfte selbst einen akademischen Abschluss. Von den Kindern aus bildungsfernen Familien schaffen das nur sechs Prozent. Weniger als ein Drittel der Erwachsenen in Österreich haben eine höhere Ausbildung als ihre Eltern.
Amela Mirkovic hat es als Tochter bosnischer Gastarbeiter der ersten Generation zwar geschafft, gegen den vererbten Bildungsstatus anzukämpfen. Sogar ein Studium hat die Alleinerzieherin neben Kindern und Arbeit noch absolviert und alles daran gesetzt, ihren Kindern den Bildungsaufstieg weiter zu vermitteln. Erfolglos. Ana, die älteste Tochter, hat die Schule mit 15 abgebrochen und arbeitet seitdem als Drogeriemarktverkäuferin. Endlich eigenes Geld zu verdienen, meint Amela Mirkovic, hat dabei eine wesentliche Rolle gespielt. Denn das Argument ihrer Tochter Ana in zahllosen Diskussionen: "Mama, du hast neben Arbeit und uns Kindern zwar studiert. Und, bringst du uns durch?"
Dabei entscheidet Bildung über Leben, auch im wörtlichen Sinn. Österreicher ohne Schulabschluss leben um sechs Jahre kürzer als Akademiker. Wer unter der Armutsgrenze lebt, weist einen dreimal schlechteren Gesundheitszustand auf als Menschen mit hohem Einkommen.
Überhaupt ist der Durchschnitts-Österreicher im Lauf des Lebens ganze acht Jahre länger krank als etwa Menschen in Schweden. "In Österreich haben Kapitalausstattung und sozialer Status der Eltern einen weit höheren Einfluss als etwa in den skandinavischen Ländern, mit denen sich Österreich durchaus vergleichen könnte", so der Armutsforscher Clemens Sedmak.
"In fast allen Gesellschaften sehen wir, dass die Stellung des Einzelnen in der sozialen Hierarchie unmittelbar mit seiner Gesundheit verknüpft ist. Je niedriger Menschen in der Hierarchie stehen, desto mehr Krankheiten haben sie, desto höher ist die Sterberate und desto kürzer ist ihre Lebenserwartung", sagt Michael Marmot. Der Epidemologe untersucht mit seinem Forscherteam seit rund 35 Jahren zehntausende öffentlich Bedienstete im Londoner Regierungsbezirk Whitehall, um den Zusammenhang zwischen Gesellschaftssystem und Gesundheit näher zu erforschen. Für seine bahnbrechenden Erkenntnisse wurde Marmot von der Queen sogar zum Sir erhoben. Denn es sind nicht die üblichen Verdächtigen – Rauchen, Trinken, schlechte Ernährung –, die alleine den schlechteren Gesundheitszustand der sozial Schwächeren erklären, so Marmot. "Nur ein Drittel der Unterschiede ist auf die klassischen Risikofaktoren zurückzuführen." Den entscheidenden Einfluss fand Marmots Team schließlich beim Ausmaß von Selbstbestimmung und Anerkennung am Arbeitsplatz.
"Je niedriger jemand in der Hierarchie steht, desto weniger Kontrolle und Einfluss hat er", so Marmot. "Der zweite Faktor ist, dass Menschen zwar große Bemühungen erbringen, aber keine angemessene Belohnung dafür bekommen. Das kann Geld bedeuten, aber auch Beförderung, oder einfach Anerkennung und Selbstwert. Mit diesem Ungleichgewicht wächst das Risiko von gesundheitlichen und mentalen Problemen."
Ob wir früher krank werden oder gar sterben, hängt also entscheidend davon ab, wie gut wir uns in der Gemeinschaft einbringen können und wie positiv unsere Mitmenschen auf unsere Bemühungen reagieren. Anders gesagt: Fairness und Gerechtigkeit entscheiden über Lebenschancen.
Das Ereignis Piketty: Ein Buch verändert die wirtschaftspolitische Debatte
Robert Misik in FALTER 34/2014 vom 20.08.2014 (S. 50)
Eine "intellektuelle Sensation" sei dieses Buch, jubelt die New York Times, und auch Martin Wolf, der Starkommentator der Financial Times ist ganz ergriffen: "Außerordentlich wichtig", schreibt er, sei dieses Buch.
Paul Krugman, der linke, keynesianische Wirtschaftsnobelpreisträger, nennt die Arbeit "eine Erleuchtung" und spricht bereits von der "Piketty-Revolution". Dieses Buch werde "die Art, wie wir über unsere Gesellschaft denken, und die Wirtschaftswissenschaft verändern".
Der linke Essayist Will Hutton sekundiert im Guardian: "Man muss in die 1970er zu Milton Friedman zurückgehen, um einen Wirtschaftswissenschaftler zu finden, der einen solchen Einfluss ausübte."
Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist Piketty schlicht "der neue Star". Der amerikanische Finanzminister hat das Buch auch studiert, und der Papst, ist zu hören, liest es gerade.
Bei Büchern, die eine solche Aufnahme erfahren wie Thomas Pikettys "Capital in the Twenty-First Century", hat eine Rezension beinahe etwas Unangemessenes. Das eigentliche Ereignis ist die Rezeption, die es erfährt. Eine solche Rezeption lässt sich mit dem Erkenntnisgewinn oder der Originalität eines Buches allein überhaupt nicht mehr erklären. Sondern: Etwas ist offenbar in der Luft gelegen.
Das ist umso augenfälliger, als der Hype um Pikettys grandiose Studie und die Originalität seiner Erkenntnisse ja in einem merkwürdigen Kontrast zueinander stehen. Das Buch, das man am ehesten als wirtschaftshistorische Großstudie charakterisieren kann, weist nach: Vermögen konzentriert sich. In nahezu allen entwickelten kapitalistischen Ländern besitzen die obersten zehn Prozent heute wieder mehr als 60 Prozent aller Vermögen – und das oberste eine Prozent konzentriert seinerseits allein über 30 Prozent. Die Mittelschicht erodiert. Und die untere Hälfte besitzt nichts.
Das allerdings haben wir schon vor Pikettys monumentalem Wälzer gewusst. Was das Buch so speziell macht, ist die ungeheure empirische Materialfülle, das Zwingende seiner Beweisführung und drittens der Nachweis, dass das im Kapitalismus unter normalen Bedingungen einfach so sein muss: Wenn es nicht überdurchschnittlich hohes Wachstum, hohe Besteuerung von Kapital und dessen Erträgen und sonstige außergewöhnliche Faktoren gibt, dann ist die Kapitalrendite immer größer als die Wachstumsrate und damit der Zuwachs bei Löhnen, Gehältern und sonstigen "normalen" Einkommensarten.
Aufstieg durch Arbeit? Gibt's allenfalls in homöopathischen Dosen. In der Realität scheißt der Teufel immer auf den größten Haufen. Piketty zeigt, "dass der Kapitalismus von sich aus keine natürlichen Regelmäßigkeiten aufweist, die Ungleichheit begrenzen. Wohl aber kann sie ständig zunehmen", formuliert beispielsweise Pikettys Ökonomenkollege Giacomo Corneo.
Bleiben die vorherrschenden Tendenzen unverändert, dann wird in ein paar Jahrzehnten wieder jener bizarre Grad an Ungleichheit erreicht sein, wie er Ende des 19. Jahrhunderts herrschte: Eine Oligarchie der obersten zehn Prozent besitzt 90 Prozent der Vermögen, diese vermehren sich ohne großes Zutun und werden vererbt.
Leistung, die sich lohnt? Fehlanzeige. "Es ist schwer, sich eine Ökonomie vorzustellen, die damit fortfährt, unbegrenzt so zu funktionieren, ohne dass extreme Konflikte zwischen den sozialen Gruppen entstehen", ist Piketty sicher.
In den vergangenen Jahrzehnten entstanden überall "politische Regimes, die objektiv privates Kapital begünstigen". Durch den Wettlauf nach unten – Stichwort: Standortwettbewerb – wurde Kapital gegenüber Arbeitseinkommen sogar noch privilegiert.
Pikettys Plädoyer ist es, dieses Verhältnis wieder umzudrehen. Durch Erbschaftssteuern, eine global konzertierte Steuerharmonisierung, eine progressive globale Kapitalsteuer (global im Sinne von international akkordiert, aber von den Nationalstaaten bzw. der EU eingehoben), die flach beginnt und bei den höchsten Vermögen konfiskatorisch wirkt. Das hat dem Autor schon den Vorwurf eingehandelt, seine Vorschläge seien absolut unrealistisch.
Aber so unrealistisch ist die Idee gar nicht. In praktischer Hinsicht ist heute eine Besteuerung von Finanzvermögen eigentlich völlig unkompliziert. Die Europäische Union hat sich vor 20 Jahren darangemacht, die nationalen Währungen abzuschaffen und sie durch die Einheitswährung Euro zu ersetzen. Dagegen ist die Idee akkordierter Steuerstandards für Kapital und dessen Erträge nun wirklich keine fantastische Vorstellung.



