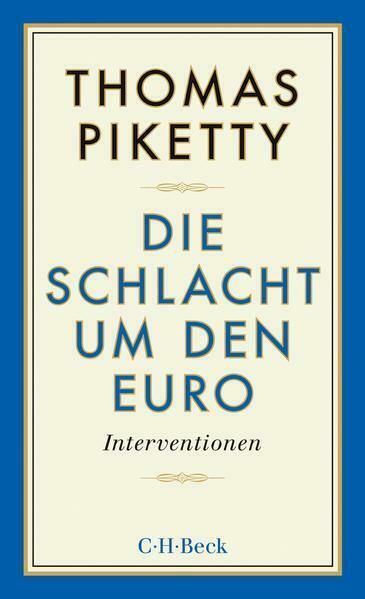Pikettys Plädoyer für einen Polit-Schock von links
Markus Marterbauer in FALTER 22/2015 vom 27.05.2015 (S. 20)
Der Ökonom Thomas Piketty hat eine lesenswerte Handreichung mit konkreten Lösungsansätzen für die Euro-Finanzkrise vorgelegt
Thomas Piketty ist der herausragendste jüngere Ökonom unserer Zeit. Das 2013 erschienene und mittlerweile in 33 Sprachen übersetzte Opus magnum des 44-Jährigen, "Das Kapital im 21. Jahrhundert", erzielte bislang eine Auflage von mehr als einer Million Exemplaren. Der Erfolg des Buches hat vor allem drei Ursachen: Es stellt die zunehmende Ungleichheit der Verteilung von Vermögen und Einkommen in den Mittelpunkt der Erklärung und trifft damit einen Nerv der Zeit; es besticht durch eine Fülle von empirischen Daten über einen langen Zeitraum und bietet eine "große Erzählung" über die Bewegungskräfte des Kapitalismus; und Piketty ist ein Ökonom, der sich im akademischen Zentrum der Wirtschaftswissenschaften höchste Anerkennung erworben hat.
Piketty hat auch in den am besten bewerteten Zeitschriften des Mainstreams sehr erfolgreich publiziert. Bereits im "Kapital im 21. Jahrhundert" hat er aber darüber hinaus bewiesen, komplexe Zusammenhänge in einfacher Weise beschreiben und der breiten Öffentlichkeit vermitteln zu können. Piketty gehört jener in Europa kaum existenten, aber in den USA weit verbreiteten Spezies von intellektuellen Ökonomen an, die fachlich in der Lage und auch persönlich bereit sind, in die öffentliche wirtschaftspolitische Debatte einzugreifen.
Er tut dies mit Bravour in seinem neuen Buch "Die Schlacht um den Euro". Der schmale Band versammelt 40 Interventionen, die ursprünglich zwischen 2008 und 2015 in der linksliberalen französischen Tageszeitung Libération erschienen sind. Damit werden nicht nur wertvolle Einblicke in das Denken Pikettys ermöglicht, sondern auch in die Geschichte der seit mehr als sieben Jahren anhaltenden EU-Finanzkrise geboten.
Schonungslose Regulierung
Die Finanzkrise ist die Folge wachsender Ungleichheit von Einkommen und Vermögen, der neoliberalen Deregulierung der Finanzmärkte und der ungenierten Selbstbedienung der Bankmanager. Schon im September 2008 stellt Piketty die Frage, die die Öffentlichkeit noch heute bewegt: "Soll man die Banken retten?"
Er zeigt, wie die Wirtschaftspolitik aus den Fehlern der 1930er-Jahre lernte und pragmatisch das Finanzsystem stützte. Dies hat dazu beigetragen, eine tiefe Depression zu vermeiden. Doch für Gesellschaft, Steuerzahler und Gesamtwirtschaft ist die Bankenrettung nur dann sinnvoll und akzeptabel, wenn gleichzeitig Banken und Banker für ihre Fehler zahlen. In diesem Sinn ist eine schonungslose Regulierung des Finanzsystems, die Beendigung der obszönen Vergütungspraxis im Finanzsektor, eine progressive Besteuerung der höchsten Einkommen und ein hartes Vorgehen gegen Steueroasen notwendig. Hier hat die Politik - auch unter dem schädlichen Einfluss der nach wie vor mächtigen Bankenlobby - weitgehend versagt. Werden die Verursacher nicht zur Rechenschaft gezogen, dann bereitet das den Boden für die nächste Finanzkrise. Es bedeutet aber auch eine massive Umverteilung von unten nach oben. Die Kosten der Krise zahlen Arbeitslose und Steuerzahler und nicht der verursachende Wirtschaftsbereich. Die Finanzkrise verschärft so die Verteilungskrise in der EU.
"Was muss noch passieren, dass sich Europa bewegt?" Piketty sieht im Abschlussbeitrag des Bandes vom Jänner 2015 drei mögliche Entwicklungsalternativen für die EU. Erstens: eine neue Finanzkrise; sie würde für Europa den letzten entscheidenden Stoß zum sozialen, wirtschaftlichen und politischen Absturz bedeuten. Zweitens: die extreme Rechte an der Macht, das ist gerade für Frankreich ein höchst reales und gefährliches Szenario. Drittens: ein "politischer Schock von links". Piketty macht klar, dass er diese dritte Alternative präferiert, weil sie die Lösung der sozialen Frage in den Mittelpunkt stellt und das europäische Projekt retten kann. Er fordert deshalb eine enge Zusammenarbeit der proeuropäischen Kräfte mit der von Syriza geführten Regierung in Griechenland und der aufsteigenden Oppositionspartei Podemos in Spanien. Was wären die entscheidenden Elemente einer fortschrittlichen und demokratischen Wirtschaftspolitik in der EU?
Ein EU-Haushaltssenat muss her
Zunächst geht es um einen expansiven Impuls, der Europa wirtschaftlich wieder auf die Beine bringt und dazu beiträgt, die Massenarbeitslosigkeit zu verringern. Zu seiner Finanzierung ist eine gemeinsame Kreditaufnahme der Staaten notwendig, um den Finanzspekulanten das Wasser abzugraben. Dann sollte die Europäische Zentralbank diese Eurobonds ankaufen, ganz nach dem Vorbild der amerikanischen Notenbank Fed.
Dieses vernünftige Maßnahmenbündel kann aber nur dann sinnvoll in die Praxis umgesetzt werden, wenn die Schuldaufnahme von einer demokratisch legitimierten europäischen Instanz überwacht wird. Piketty schlägt in diesem Sinn die Gründung eines europäischen Haushaltssenats vor, der sich aus Abgeordneten der Finanz- und Sozialausschüsse der nationalen Parlamente zusammensetzt. Gemeinsame Wirtschaftspolitik mit demokratischer Legitimation - das wäre ein großer Schritt nach vorn auf dem Weg zu einer politischen Union. Vergemeinschaftet werden soll alles, "was uns alleine nicht gelingt": Eurobonds, Körperschaftssteuer, Finanzmarkt-und Bankenregulierung, automatischer Informationsaustausch über Finanzvermögen und endlich die Durchsetzung einer europäischen Vermögenssteuer. Sie bleibt ein besonderes Anliegen Pikettys.
Thomas Piketty erweist sich in seinen Interventionen einmal mehr als Ökonom mit Weitblick, der nicht nur nach wirtschaftspolitischen Lösungen für die europäische Krise sucht, sondern dies überzeugend in Sorge um die Demokratie und den sozialen Zusammenhalt tut.