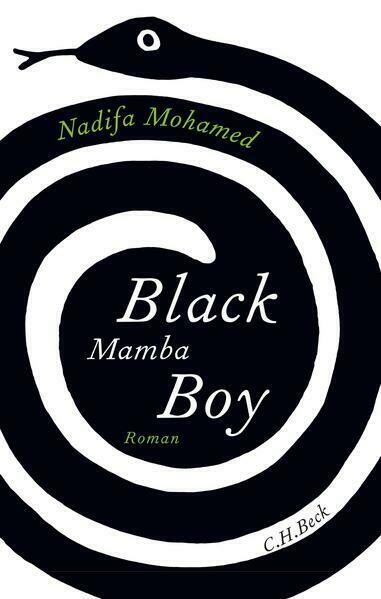Vater geht auf Reisen
Sigrid Löffler in FALTER 22/2015 vom 27.05.2015 (S. 35)
Exemplarisch: Nadifa Mohameds Epos über einen somalischen Buben, der sein Glück in England sucht
Dies ist der Roman der Stunde. Er erzählt exemplarisch die Odyssee eines jungen Afrikaners, der ein besseres Leben sucht, als sein Herkunftsland Somalia ihm bieten kann, und der unter ungeheuren Strapazen seinen Weg nach Europa findet. "Black Mamba Boy" erzählt von Heimatverlust, Entwurzelung und Armutsmigration, aber auch vom unbezähmbaren Lebensmut eines afrikanischen Buben, dessen Chancenlosigkeit mit seiner Geburt festzustehen scheint, der sich davon aber nicht entmutigen lässt.
Der Roman basiert auf der Kindheits- und Jugendgeschichte des Vaters der somalischen Autorin Nadifa Mohamed, der es in den 1930er-Jahren, zur Zeit der Herrschaft Mussolinis in Ostafrika, in einer zwölfjährigen Irrfahrt von Somalia bis nach England schaffte. Der Roman greift aus in die komplizierte Kolonialgeschichte der Region um das Horn von Afrika und findet eine Parallele zu den afrikanischen Entwurzelungen in der berüchtigten Geschichte des Schiffes "Exodus" mit tausenden entwurzelten Holocaust-Überlebenden an Bord. Die Briten verweigerten diesen Flüchtlingen 1947 die Landung in Palästina und schickten sie auf dem Frachter "Runnymede Park" nach Hamburg zurück.
So ähnlich, wie den Juden das Leben in ihren europäischen Vaterländern unmöglich gemacht und die Landung in ihrem "spirituellen Heimatland" verwehrt wird, irren auch die entwurzelten Afrikaner in dem Roman durch ihren enteigneten Kontinent: Auch ihnen wird das Leben in ihren Vaterländern unmöglich gemacht und die Landung im Zufluchtskontinent Europa generell verwehrt. Die Ankunft in Europa gelingt nur im Glücksfall. Nadifa Mohameds Vater Jama ist ein solches Glückskind. Die schwarze Mamba, die Jamas schwangerer Mutter im Traum erschien, erweist sich als Jamas Talisman und schützender Fetisch.
Nadifa Mohamed, geboren 1981 in Hargeisa im einst britischen Norden Somalias, floh als Kind 1986 mit ihren Eltern vor dem drohenden Bürgerkrieg ins Exil nach London und studierte in Oxford Geschichte und Politik. Ihr Debütroman "Black Mamba Boy" (2010) ist zunächst eine Vater-Sohn-Geschichte. Er beginnt 1935 in Aden, der Hafenstadt im Jemen, wo sich der zehnjährige Straßenjunge Jama sein Essen zusammenbettelt und - stiehlt und sich nachts einen Schlafplatz in einem Winkel sucht. Er stammt aus dem somalischen Hargeisa, doch da sein Vater, ein Träumer und Musiker, kurz nach Jamas Geburt die Familie verließ und verschwand, suchte Jamas Mutter Arbeit in Aden. Sie front in einer Kaffeefabrik, kann sich um den Buben kaum kümmern und stirbt früh.
Bald danach macht sich der Zehnjährige ganz allein auf die Suche nach seinem Vater. Mit nichts als dem, was er am Leibe trägt, und dem Amulett seiner Mutter um den Hals bricht er auf nach Norden, auf die vage Information hin, dass sein Vater angeblich im Grenzgebiet zwischen Eritrea und Sudan als Lkw-Fahrer arbeitet. Jama driftet durch die französische Kolonie Dschibuti in die italienische Kolonie Eritrea, wird dort als Halbwüchsiger in den Krieg zwischen Mussolinis Truppen und den Briten hineingezogen und muss erleben, wie seine Vatersuche scheitert.
Von da an hat Jamas Odyssee ein anderes Ziel: Er will sich nicht als Soldat der italienischen Faschisten verheizen lassen, für nichts als eine Uniform und eine Mahlzeit am Tage. Er will dem Krieg, der Armut und dem Hunger entkommen, er will seiner jungen eritreischen Frau, die er unterwegs überstürzt geheiratet hat, ein besseres Leben bieten, er will ans Mittelmeer, um als Matrose auf einem britischen Schiff anzuheuern.
Der inzwischen Achtzehnjährige durchquert die Wüsten Sudans, Nubiens und des Sinai, er irrt durch Ägypten und Palästina, wird überall weggeschickt, eingesperrt oder abgeschoben. Schließlich ergattert er doch einen britischen Pass, der es ihm ermöglicht, auf einem britischen Frachter anzuheuern. Es ist just der Frachter "Runnymede Park", der die gestrandeten Juden der "Exodus" zurück nach Hamburg transportiert, aber Jama endlich in England landen lässt. Erstmals hat er Geld in der Tasche, erstmals kann er daran denken, seiner Familie in Afrika ein besseres Leben zu bieten.
Nadifa Mohamed hat die abenteuerliche Geschichte ihres Vaters mit fiktionalen Zügen angereichert. Jamas Irrfahrten werden immer wieder gesteuert von glücklichen Zufällen. Unterwegs trifft Jama auf andere Umherirrende, mit denen er sich anfreundet, und auf Menschen, die ihn in schlimmsten Notlagen auf der Straße aufklauben, ihm zu essen geben und ihm weiterhelfen. Vor allem funktioniert das Netzwerk der Clan-Zugehörigkeit, die Somaliern immer und überall gebietet, Clan-Mitgliedern beizustehen. Nur so kann Jama die unglaubliche Mühsal seiner Reise - Durst, Malaria, Krieg und andere Unbill - überstehen.
Am Ende, in London, der Metropole der Weltmigration, trifft er zufällig einen Gefährten von früher. Die beiden jungen Somalier "wetteiferten, wer wohl die größte Strecke zurückgelegt, am längsten gehungert, sich am hoffnungslosesten gefühlt hatte; sie waren Teilnehmer bei der Olympiade der Schicksalsschläge". Beide fühlen sich als Nomaden und sehen sich gezwungen, den Begriff "Heimat" umzucodieren. Sie haben gelernt, das Unterwegssein als eine Art Heimat zu betrachten. Als Migranten sind sie Pioniere und zugleich Leitfiguren der mobilen Moderne.