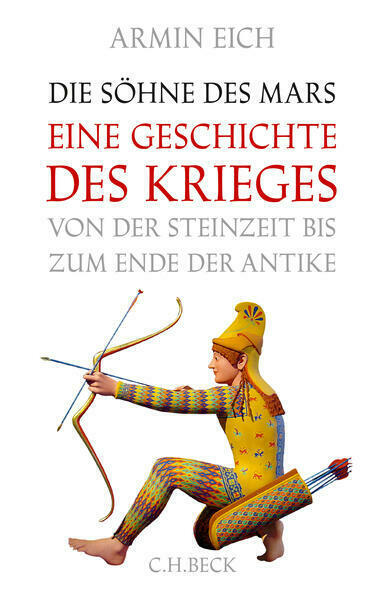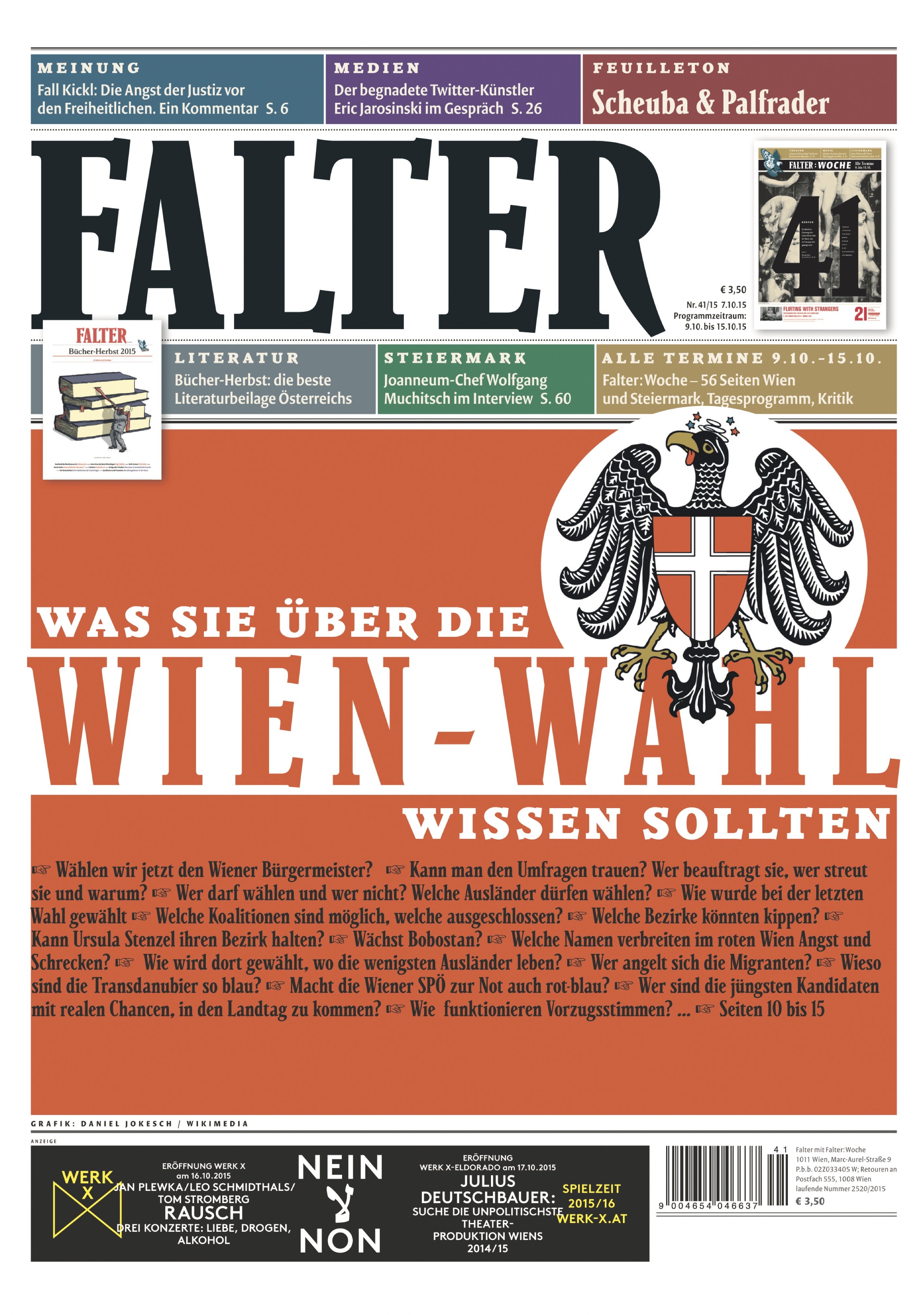
Waffenfetischismus oder Pazifismus?
Sebastian Kiefer in FALTER 41/2015 vom 07.10.2015 (S. 37)
Geschichte: Armin Eich erzählt die Geschichte des Krieges und bezweifelt, dass dieser zum Menschen gehört
Der eigentliche Sündenfall der Menschheit ereignete sich für den Althistoriker Armin Eich am Ende der Jungsteinzeit, zwischen 8000 und 5000 v. Chr.: Zwar wurde schon etwa ab 11.000 v. Chr. im Nahen Osten Getreide angebaut, doch lebten diese frühen Siedlungen, oft an gut erreichbaren und von Natur begünstigten Plätzen, lange in friedlicher Koexistenz. Bis ins ausgehende 7. Jahrtausend fehlen Anzeichen kollektiver Gewalt oder des Bedrohtseins. Erste Befestigungen entstanden oft an Knotenpunkten des Handels, waren doch hier begehrte Waren in großer Menge versammelt. Regelrechte Festungen lassen sich erst im 5. Jahrtausend nachweisen.
Die entwickelten Gesellschaften bildeten in dieser Epoche eigene, auf Krieg spezialisierte Männerkasten und Kriegsökonomien heraus. Geplante Kollektivgewalt wurde zur Basis staatlichen Handelns zwecks Mehrung von Macht und Besitz. (Mittel-)Europa folgte mit Zeitverzögerung nach, in der Bronzezeit war Europa mit dem Vorderen Orient schon dicht vernetzt und die Entwicklungen glichen sich an.
Im beginnenden 2. Jahrtausend tauchten in Europa Kriegerfürsten auf, die wohl aus dem Handel mit Metallen hervorgegangen waren. Plastische Darstellungen dokumentieren den Wertekodex: „Waffenfetischismus, Wagenbesitz und -fahren, Betonung imponierender Körperlichkeit und Verschönerung der körperlichen Präsenz durch Schmuck“. Die Militarisierung gehorchte einer Steigerungs- und Eskalationsdynamik. Ägypten war das Urbild einer zentralisierten Monarchie, die über eine Kernarmee professioneller Soldaten verfügte, mit denen umliegende Gebiete brutal kolonisiert wurden. Die Nachbarvölker waren ab etwa 3300 v. Chr. um ihres Überlebens willen gezwungen, große Festungsbauten anzulegen und die technischen und strategischen Innovationen zu kontern.
Der Rüstungswettlauf mündete in eine Eskalation der Gewalt: Der „Seevölkersturm“ des 12. Jahrhunderts v. Chr. läutete das Ende des Bronzezeitalters ein. Es folgten Jahrhunderte der Erschöpfung, langsam bildete sich eine Reihe kleiner Monarchien (darunter Juda und Israel) heraus, das Wettrüsten intensivierte sich wieder, bis komplexe Staatsgebilde mit großen Armeen auf der Basis technischer und strategischer Innovationen operierten, via Militärtechnik und Ressourcenstärke vorübergehende Hegemonie erlangend.
Das Zeitalter vom 8. Jahrhundert v. Chr. bis zum Ende der Antike war von Massenaufgeboten mit der Konzentration auf den disziplinierten Infanteriekampf bestimmt. Immer entscheidender wurde nun die Verwissenschaftlichung der Waffentechnik. Fachleute des Krieges wurden oft entscheidend.
Armin Eich erzählt in „Die Söhne des Mars“ nicht nur die euro-orientalische Frühgeschichte des Krieges, er schreibt seinem eminent lehrreichen und komplex argumentierenden Buch auch eine subjektiv gefärbte Botschaft ein: Er schlägt sich auf die Seite von Epikur, Lukrez und Rousseau und will beweisen, dass der Krieg keineswegs (wie einst Platon, Thukydides und Hobbes, heute Ian Morris und Steven Pinker behaupteten) zur Natur des Menschen gehört.
Eichs Hauptzeugen sind jene „kriegslosen Völker“, von denen 70 noch heute in entlegenen Refugien leben und vermutlich sehr alte Daseinsformen fortsetzen: Einige kennen nicht einmal Worte, um Mord zu bezeichnen. Sie sind weitgehend egalitär ausgerichtet und grenzen sich bewusst (und mitunter humorvoll) von einer als unrein und gewalttätig empfundenen Umwelt ab und ahnden im Alltag schon kleinste Ansätze der Aggression.
Da sie in der Regel seminomadisch als Jäger und Sammler leben, kann Jagd keine unvermeidliche Vorstufe kriegerischer Aktivitäten sein. Ob wir es mit Verkörperungen eines verlorenen, reineren Zustands des Menschen zu tun haben, darf man bezweifeln. Dass dort, wo Menschen dichter beieinander leben, erhöhtes Konfliktpotenzial entstehen muss, ist andererseits ein Gemeinplatz.
Die literarischen Klassiker der alten Griechen fungieren in Eichs Erzählung als hochvirtuose Selbstreflexionen des traumatisierenden Potenzials einer Zivilisation, die das Militärische naturalisiert hat. Doch symptomatisch ist, wie Eich das Verhältnis der Griechen zum Krieg reduktiv umdeutet: Achilles, kultisch verehrtes Idol von Generationen, verlor sich, anfangs edelmütig, in Homers „Ilias“ gerade nicht bis zum Wahnsinn in Gewalt, weil er etwa kriegstraumatisiert war. Auslöser der Raserei war zweierlei: die Kränkung seiner Mannesehre – Agamemnon entwendete ihm die Liebessklavin – und die Schuld am Tod des geliebten Patroklos.
So eindrucksvoll Eich argumentiert, er versucht kleinzureden, was tatsächlich unerträglich zu denken ist: Krieg wurde nie nur traumatisierend oder böse oder amoralisch erlebt, er war immer auch ein Medium der Sehnsüchte und der Mobilisierung von Lebenskräften, der Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis und ein Ausdruck einer sich besonders hoch und ideal wähnenden Moral. Er war ein Fluch der Zivilisation, eine ihr größten Gefährdungen und hat doch zum zivilisatorischen Fortschritt und zur Steigerung des Wohlstands beigetragen, zur Entwicklung der Künste, er hat zu Erfindungen geführt und zur Entdeckung neuer Lebensformen.
Das als Historiker zugestehen zu müssen, ist traurig genug, bedeutet jedoch in keinster Weise, den Krieg zu bejahen als Mittel der Politik, der Macht- und Wohlstandsmehrung oder auch nur als letzten Ausweg in Konfliktlösungen. Welche Haltung man heute, in komplexen Wohlstandsgesellschaften, dazu einnimmt, wird von der Kenntnis sehr einfacher, kriegsloser Gesellschaften nicht tangiert.