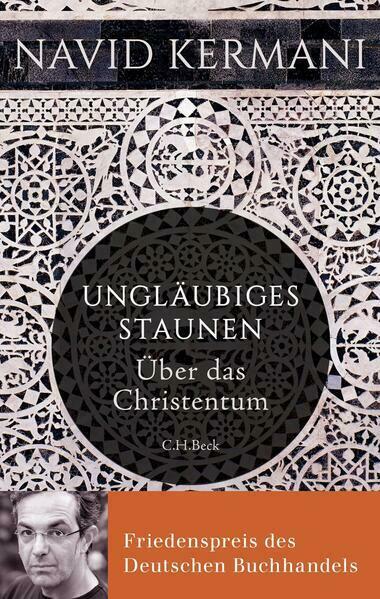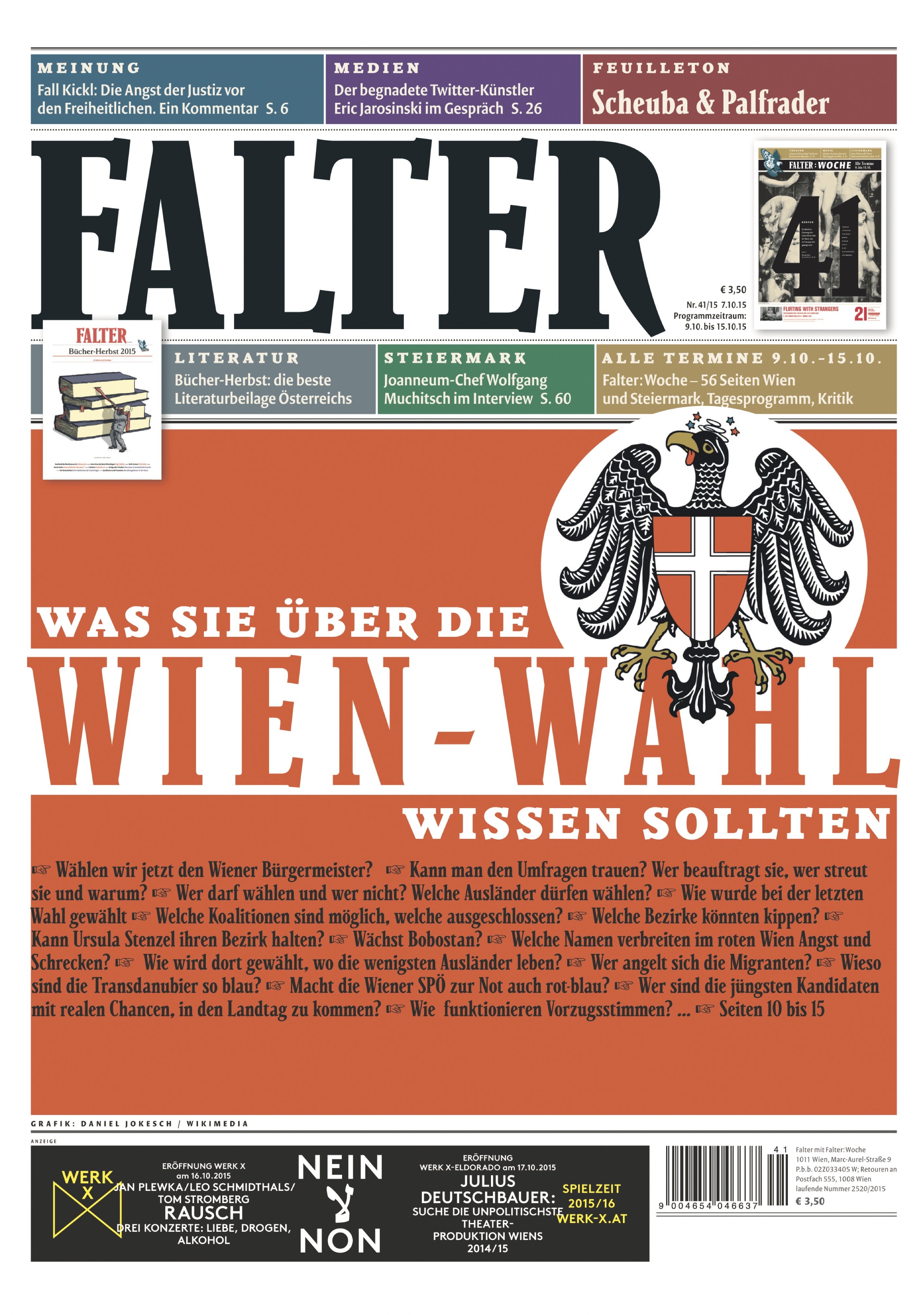
Die Versöhnung des heiligen Franziskus mit den Sufis
Thomas Leitner in FALTER 41/2015 vom 07.10.2015 (S. 40)
Religion: Der Autor und Moslem Navid Kermani entwirft ein Christentum des friedliebenden Strebens nach Allharmonie
Kaum ein Intellektueller ist in letzter Zeit so in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt wie der Orientalist, Publizist und Schriftsteller Navid Kermani. Er entstammt einer Familie aus dem schiitischen Isfahan im Iran, wurde 1967 im deutschen, protestantischen Siegen geboren und lebt heute in Köln, bekanntlich die sinnenfreudige Hochburg des rheinischen Katholizismus. Nach Auszeichnungen wie dem Arendt-, Cicero- und Kleist-Preis erhält er nun – laut Begründung der Jury – „als Autor, der mit großer Sachkenntnis in die theologischen und gesellschaftlichen Diskurse einzugreifen vermag“, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
Groß also die Aufmerksamkeit für dieses Buch, das pünktlich zur Verleihung und thematisch abgestimmt auf diese Ehrung erscheint. Noch höher war die Erwartung eines Lesers, der bisher schon von seinen Romanen wie von der Vielfalt seiner Essays und Reiseberichte begeistert war, die von einem vibrierenden Streben nach west-östlicher Synthese durchdrungen sind.
Vielversprechend denn auch das erste Durchblättern des Buches, das Kermanis Begegnungen mit der Bilderwelt des Christentums, zumal des katholischen, thematisiert. Schon der Einband besticht durch die wunderbare Verschmelzung orientalischer Ornamentik mit antikisierend-romanischem Bildgut. Kaum verwunderlich liegt ein Schwerpunkt der ausgewählten Bilder bei Caravaggio, hat dieser doch wie sonst niemand im Rahmen der religiösen Malerei allgemein menschliche Gefühle ausgedrückt. So ist die Betrachtung der berühmten Berufungsszene des Apostels Matthäus (San Luigi dei Francesi/Rom) eine der brillantesten Passagen. Wie Kermani die Unsicherheit der ins Chiaroscuro getauchten Akteure auf den Betrachter überspringen lässt und das titelgebende „Ungläubige Staunen“ (Untertitel: „Über das Christentum“) auslöst, ist schlechthin meisterhaft.
Ein weiteres Glanzlicht bildet die Meditation über El Grecos „Abschied Christi von seiner Mutter“, in der Kermani die erotische Ausstrahlung der ineinander in Liebe versinkenden Blicke herausstreicht.
Auch in diesem Buch berückt der unverwechselbare Ton der langen, melodiösen Sätze, in dem Kermanis Vertrautheit mit den größten Sprachkünstlern der deutschen Klassik ebenso anklingt wie sein Umgang mit nahöstlicher Atem- und Rezitationstechnik: Der Text drängt darauf, laut gelesen zu werden.
Viele der assoziativen Meditationen zu den 40 Bildwerken (vom frühchristlichen Mosaik bis zu Gerhard Richters Glasfenstern im Kölner Dom) verflechten tiefsinnig ästhetische Erfahrung mit Überlegungen zur christlichen Ethik. So bestechen die gedanklichen Verbindungen, die er zwischen dem ravennatischen Pastora-Motiv des Hirten-Erlösers und dem römischen sol invictus knüpft, ebenso wie die Brücke, die er zwischen Richters abstraktem Werk und der Lichtmystik eines Sufidichters herstellt.
Und dennoch: Bei kontinuierlicher Lektüre schleichen sich beim Leser, der nicht primär an religiöser Erbauung interessiert ist, Irritation und Distanz ein. Es stört nicht so sehr der Umstand, dass es sich bei den meisten der Kapitel um wiederverwertetes Material handelt, etwa aus seinem Romangebirge „Dein Name“ (2011), v.a. aber aus in der NZZ erschienenen Artikeln.
Nicht, dass der Katholizismus einseitig im Zentrum steht und die Auseinandersetzung mit Pietismus, Aufklärung und deutschem Idealismus fehlt, ist dabei das eigentlich Irritierende, sondern die Zugerichtetheit auf eine Botschaft hin. Ein allzu sichtbarer roter Faden zieht sich durch: die Konvergenz eines Krypto-Christentums bei gewissen islamisch-heterodoxen Gruppen (Sufis), die Jesus als höchstes Symbol der Liebe sehen, mit friedliebendem Streben nach Allharmonie, das Kermani in der Person von Franziskus begründet sieht.
Wie dieser sich von der Kreuzzugshysterie seiner Zeit fernhielt und dem Koran durchaus bewundernd gegenüberstand, so mögen sich die friedensstiftenden Tendenzen in den Religionen auch heute artikulieren und gegenüber orthodoxen Dogmatikern und fanatischen Hetzern obsiegen. Kermanis Wort in Gottes Ohr...