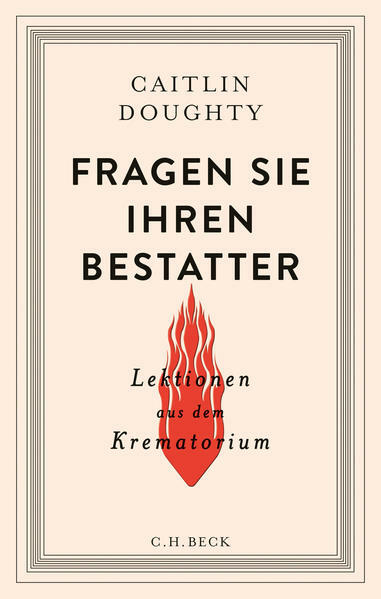Hadert nicht mit dem Tod, versteht zu leben!
Kirstin Breitenfellner in FALTER 11/2016 vom 16.03.2016 (S. 30)
Immer weniger Menschen wollen etwas von ihm wissen. Dabei schärft die Beschäftigung mit dem Tod die Sinne für das Leben. Drei neue Bücher schauen den Tatsachen des Sterbens ins Auge, ohne Sentimentalitäten, mutig und, ja, sogar unterhaltsam
Den Tod ins Leben zu holen – das heißt nicht, den Tod mehr zu lieben als das Leben, wie es sich etwa der islamistische Terror gerne einredet. Es bedeutet, den Tod zu akzeptieren als das unvermeidbare Ende des Lebens und als den Umstand, der das Leben erst definiert.
Drei Autorinnen nähern sich diesem Menschheitsthema, das in unserer Gesellschaft verleugnet wird wie vermutlich nie zuvor, aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Wiener Journalistin Katharina Schmidt, Jahrgang 1983, betrachtet die unmittelbare Phase des Sterbens, die amerikanische Bloggerin Caitlin Doughty, geboren 1984, interessiert sich vor allem dafür, was mit dem Leichnam passiert. Und Susanne Mayer, geboren 1952, betrachtet das langsame Nahen des Todes an ihrem eigenen Leibe.
Kultur des Sterbens
Warum interessiert sich ein junger Mensch, der, wie es so schön heißt, noch sein ganzes Leben vor sich hat, für das Sterben? Katharina Schmidt, Innenpolitik-Redakteurin bei der Wiener Zeitung, begleitete vor sechs Jahren ihren Vater in den Tod. Konsequenterweise beginnt sie ihr mutiges und wichtiges Buch „Eine sonderbare Stille. Warum der Tod ins Leben gehört“ mit diesen persönlichen Erfahrungen, die vermutlich dazu beigetragen haben, dass die junge Autorin eine erstaunliche Reife zeigt – von der Wahl ihres Themas bis zu dessen Ausführung und vor allem ihrer Argumentation.
Dem Sterben des eigenen Vaters zuzuschauen war nicht leicht, lautet ihr Fazit, aber: „Die Angst vor dem Tod war unbegründet. Denn mein Vater ist exakt so gestorben, wie es für ihn gepasst hat. (…) Alleine dieses Wissen ist uns ein wichtiger Trost geworden. Vielleicht aber hätten wir uns alle – allen voran mein Vater selbst – weniger vor dem Tod und dem Sterben gefürchtet, hätten wir uns vorher damit beschäftigt.“
Natürlich könne man sich auf das Sterben selbst nicht vorbereiten, denn es komme immer anders, als man denke, aber die „essentiellen Fragen des Lebens und des Sterbens“ könne man sich schon früh, das heißt rechtzeitig stellen.
Die Akzeptanz unserer Sterblichkeit lehre uns Achtsamkeit und Demut vor dem Leben und Respekt vor den Menschen. „Und wir können unser eigenes Leben intensiver genießen, wenn uns seine Endlichkeit bewusst wird.“
Akzeptanz des Todes
Warum wird der Tod, die Tatsache, dass wir alle sterben müssen, in unserer Gesellschaft verdrängt? Der Tod beleidige unser Kontrollbedürfnis und den modernen Anspruch, „unendlich konsumieren und genießen zu können“, konstatiert Schmidt und demonstriert die Verdrängung des Todes anhand von anschaulichen Beispielen.
Während sich in unsere Wohnungen via Computer und Fernseher Massen von Leichen drängen, erscheint uns die eigene Sterblichkeit paradoxerweise „so fremd und surreal wie wohl noch nie in der Menschheitsgeschichte“. Schmidt zitiert „Die Geschichte des Todes“ von Philippe Ariès, der schon 1977 die Ausbürgerung des Todes aus dem öffentlichen Leben und einen Verlust einer Kultur des Abschieds monierte. Heute kann es schon zu einer Gratwanderung werden, jemandem auf angemessene Weise zum Tod eines nahen Verwandten zu kondolieren.
Wer die Sterblichkeit ignoriert, kann so tun, als lebe er unendlich. Der so gewonnene Freiraum aber sei ein Betrug an uns selbst, meint Schmidt, denn im Hinterkopf hätten wir immer Angst vor dem Tod, dem Sterbeprozess und dem tatsächlichen Totsein.
Unter dem Paradigma des Jugendkults werden alte Menschen an den Rand gedrängt, und das, obwohl es immer mehr ältere Menschen gibt. Würde und Weisheit des Alters? War gestern. Heute dominiert die Wahrnehmung seiner Defizite, die Angst vor Alzheimer und die latente Verachtung jener, die nicht mehr auf dem Gipfel ihrer Leistungsfähigkeit stehen.
Aber die Tabuisierung des Sterbens hat auch mit der Entwicklung der modernen Medizin zu tun.
Gian Domenico Borasio, der sich als Palliativmediziner damit auseinandersetzt, wie sich die letzte Phase des Lebens möglichst human und schmerzfrei gestalten lässt, hat dafür den Begriff vom Tod als narzisstischer Kränkung für den Arzt geprägt, der sich der Rettung von Leben verschrieben hat, die Tatsache des Sterbens als persönliches Versagen empfindet und aus diesem Grund oft nicht mehr den richtigen Zeitpunkt für das Einstellen von Therapien findet.
Immer mehr Ärzte, moniert Schmidt, lassen ihre Patienten im Sterben allein, schleichen sich in der Visite an ihnen vorbei.
Was ist ein würdevoller Tod?
In diese Lücke springt die Hospizbewegung, die Schmidt von ihren Anfängen kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs an porträtiert – allen voran ihre Pionierin Cicely Saunders, die 1967 das St. Cristopher’s Hospice im Londoner Vorort Sydenham gründete. Den Sterbenden Raum geben, sie dabei nicht allein lassen, dem Tod ins Auge sehen und ihn aushalten, lautet ihr Motto.
Dabei stehen Schmerzlinderung, Lebensqualität und psychologische Betreuung, also eine ganzheitliche Begleitung im Vordergrund, die den Tod weder beschleunigt noch verlangsamt. Schmidt stellt die Mitarbeiter des Wiener Hospizes am Wiener Rennweg vor, stille Helden des Alltags, und lässt Sterbende zu Wort kommen.
Was ist ein würdevoller Tod? Zuallererst ein selbstbestimmter, argumentiert Schmidt, ohne kurative Übertherapie und lebenserhaltende Maßnahmen wie künstliche oder gar Zwangsernährung. Seine notwendigen Phasen: Leugnung, Wut, Verhandeln, Depression und – im besten Falle – Akzeptanz.
Was bedeutet ein gelungenes Leben? Auch diesem Thema widmet sich Schmidt auf feinfühlige und umsichtige Art, ohne ihr Buch zum Ratgeber mutieren zu lassen. Sie plädiert dafür, den Tod mitzudenken mit dem Leben und mit alten und sterbenden Menschen so umzugehen, wie man es sich selbst im Angesicht des Todes wünschen würde. Dazu gehört auch, ein neues Gespür für den Umgang mit Trauernden zu entwickeln.
Am Anfang war die Leiche
Caitlin Doughty war 23 Jahre alt, als sie bei einem Krematorium in der Nähe von San Francisco anheuerte. Gleich am ersten Tag musste sie eine Leiche abholen und war mit einer trauernden Familie konfrontiert, die sich über ihr Erscheinen nicht eben erfreut zeigte. Wie kommt eine junge Frau zu einem solch ausgefallenen Berufswunsch? Und dann dazu, über dessen nicht eben ästhetische Details ein Buch zu schreiben?
Doughtys Begründung ähnelt jener von Katharina Schmidt: Sie habe dem Tod ins Auge sehen wollen, weil seine Verdrängung dem Einzelnen, aber auch der Gesellschaft nichts Gutes bringe. „Eine Kultur, die den Tod verleugnet, steht einem guten Tod im Weg.“
In ihrem Bericht „Fragen Sie Ihren Bestatter. Lektionen aus dem Krematorium“ steht allerdings die Periode unmittelbar nach dem Tod im Vordergrund und damit die Leiche – der Transport und das Herrichten, der Akt der Verbrennung und der Umgang mit den Hinterbliebenen.
Als Kind erlebte Doughty, die auf Hawaii aufwuchs, einen Unfall und den vermuteten Tod eines Mädchens in einem Einkaufszentrum. Seitdem hat sie das Thema nicht mehr losgelassen. Als Jugendliche wurde sie zum Goth bzw. Gruftie, ihr Studium der Geschichte schloss sie mit einer Arbeit über dämonische Geburten in der spätmittelalterlichen Hexentheorie ab.
„Meine Uni-Lektüren hatten mich angefixt, aber ich wollte mehr. Ich wollte härteren Stoff: richtige Leichen, richtigen Tod.“ Vielleicht auch ein bisschen, um die Ängste zu kurieren, die sie als Achtjährige quälten.
Es sei gewarnt: Für Doughtys Bericht aus deren „Eingeweiden“ des Krematoriums braucht es starke Nerven und einen guten Magen. Aber man liest ihn mit angehaltenem Atem, denn sie versteht es zu erzählen, haut metaphorisch ordentlich auf den Putz und lässt kein auch noch so unappetitliches Detail aus. Vom toten Körper zu erzählen, ohne morbid zu werden, muss ihr erst einmal jemand nachmachen. Anekdoten aus der Arbeit im Krematorium und über seine wortkargen, schrägen Mitarbeiter würzt sie mit wohldosierten Portionen von Gesellschaftskritik und Historie – Edutainment im besten Sinne.
Die Kunst des Sterbens
Der Gestank des Objekts, das einmal ein Mensch war, das Waschen der Leiche, das Ankleiden und Schminken, der Verbrennungsprozess mit den austretenden Dämpfen und Flüssigkeiten, das Zerkleinern der restlichen Knochen in der Knochenmühle, die Sekrete, der Staub – Unverblümtheit und Unverfrorenheit sind dabei Programm.
„Tote verankern die Lebenden in der Wirklichkeit.“ Auch Doughty schreibt gegen die Medizinisierung des Sterbens und die Unsichtbarkeit der Toten in der Öffentlichkeit an, gegen unser gestörtes Verhältnis zu ihnen, gegen das in den USA übliche Aufpumpen der Leichen mit chemischer Konservierung und deren Versiegelung in einem Beton- oder Metallsarkophag.
Sie plädiert für eine natürliche, „grüne“ Bestattung, vom Leichnam bis zur Verwendung der beim Verbrennen entstandenen Energie. Sie selbst möchte übrigens am liebsten Tieren zur Nahrung dienen, also dem ewigen Kreislauf der Natur zurückgeführt werden.
Schon während ihrer Tätigkeit im Krematorium begann Doughty als Bloggerin unter dem Namen „The Order of the Good Death“, sie betreibt einen Channel auf Youtube, „Ask a Mortician“, wo sie dank Mut, Gedankenschärfe und darstellerischem Talent ein großes Publikum erreicht, und führt heute ein eigenes Bestattungsunternehmen. Dem amerikanischen Bestatterverband nach wie vor ein Dorn im Auge, ist sie in der amerikanischen Öffentlichkeit spätestens seit Erscheinen ihres Buches im Jahr 2014 ein Star.
Alter und Stil
Wahrscheinlich ist es leichter, über den Tod zu schreiben, wenn er noch weit weg ist. Wenn die eigenen Kräfte und der Körper beginnen nachzulassen und man die erste Altersbashing-Erfahrung hinter sich hat, lässt es sich hingegen schwerer wegschauen.
Susanne Mayer blickt in ihrem Buch „Die Kunst, stilvoll älter zu werden. Erfahrungen aus der Vintage-Zone“ nicht dem Sterben als Abstraktum, sondern den eigenen Verfallserscheinungen ins Auge. Das erfordert Mut.
Der Titel von Mayers losen Betrachtungen ist irreführend. Denn auch junge Menschen lieben Vintage, aber sie würden sich nicht selbst oder ihre Haltung zum Leben so bezeichnen. Mit ihrem 60. Geburtstag wurde die stets stilbewusste Literaturkritikerin der Zeit vom Aging-Blues befallen und versucht ihm mit einem nassforschen, sarkastischen Tonfall, der oft ungewollt verzweifelt klingt, beizukommen – und mit forcierter Beschäftigung mit Styling.
Wie naht das Alter? Morgens wird es zunehmend schwieriger, in den Spiegel zu schauen. Man wackelt auf einem Bein, wenn man sich die Socken anzieht. Und nächtliches Feiern rächt sich am nächsten Morgen stärker als früher. Mayer trifft sich mit „Schicksalsgenossen“, in die Jahre gekommenen Dandys oder „Grand Old Schachteln“ wie der 88-jährigen österreichisch-amerikanischen Fotoreporterin Lisl Steiner, erzählt von bereits verstorbenen Freunden.
Sie prangert das Lächerlichmachen von Greisen an, liest Todesanzeigen, artikuliert ihre Angst davor, was nach ihrem Ableben über sie geredet und gedacht werden wird. Sie spricht über Krampfadern, „Wartungszeiten“, muffige Gerüche und ungelesene Bücher.
Das Negative der Bilanz überwiegt. Mit dem „schlimmsten aller Tyrannen“, dem Altern, kann sie sich offenbar nicht wirklich anfreunden. Und auch der Feminismus hat in ihren Augen versagt. Ihr Fazit: „Wenn man dem Tod etwas zuguterechnen könnte, dann dieses, dass er wirklich alle erwischt.“ Zurück bleibt die Frage, ob die Seitehiebe auf junge Kolleginnen wie Charlotte Roche oder Ronja von Rönne notwendig waren.
Es ließe sich darüber spekulieren, ob das etwas mit der Generation der 68er zu tun hat, der sie sich zurechnet, der ersten Generation, die sich selbst erbarmungslos dem Ideal der Jugend verschrieb. Zum Schluss nimmt sich Mayer vor, neugierig zu bleiben. Konsequent endet das Buch mit Styling- und Entspannungstipps: Vorsicht bei Schals! Nailpolish, ja bitte! Überhaupt: Schuhe! Und natürlich: Musik und Filme!
Die Frauen, das Leben und der Tod
Frauen, bemerkt Caitlin Doughty an einer Stelle, seien natürliche Komplizinnen des Todes, denn sie gebären, um mit Samuel Beckett zu sprechen, „rittlings über dem Grabe“, sie arbeiteten als Hebammen und „Death Midwives“, Todesbegleiterinnen. Den drei vorgestellten Büchern ist nicht nur gemeinsam, dass sie von Frauen geschrieben wurden, deren Zugang zum Thema durch und durch säkular zu nennen ist, sondern auch, dass sie versuchen, die Angst vor dem Tod bei den Hörnern zu packen und ihr ins Auge zu schauen.
Dabei kommen sie trotz unterschiedlicher Zugangsweisen im Grunde zu demselben Schluss, der gleichzeitig am besten benennt, was man über die Beschäftigung mit dem Tod sagen kann: Sie schärft die Sinne für das Leben.