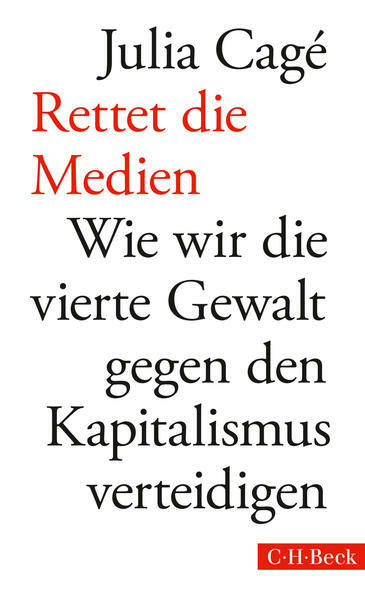Medien sind für die Demokratie relevant
Benedikt Narodoslawsky in FALTER 11/2016 vom 16.03.2016 (S. 40)
Medien: Julia Cagé will dem Qualitätsjournalismus mit einem neuen Konzept das Überleben sichern
Von 2008 bis 2012 verschwanden in Spanien rund 200 Medien. 2013 bauten die Verlage in Deutschland etwa 1000 Stellen ab. Eine Gallup-Studie aus dem Jahr 2014 zeigt, dass nur noch 22 Prozent der Amerikaner Zeitungen vertrauen. Den alten Medien geht es gar nicht gut. Wer durch Julia Cagés Buch „Rettet die Medien“ blättert, findet dafür genügend Belege.
Beispiel USA: Die Entwicklungen der Werbeeinnahmen der Zeitungen zeigen eine brutale Kurve nach unten. Anteil der Werbung am Gesamtumsatz der Zeitungen: Seit den 2000er-Jahren geht’s bergab. Entwicklung des Umsatzes der Zeitungen seit den 1950er-Jahren: konstant Richtung Tal. Alle Tageszeitungen in den USA zusammen verdienen heute nur halb so viel wie Google, das die Inhalte bloß sortiert, die andere erstellt haben.
Während Verlage sich im Kampf ums Werbegeschäft selbst zu Native Advertising hinreißen lassen (also Werbung, die sich so gut ins journalistische Produkt einfügt, dass es für Leser nur noch schwer vom redaktionellen Teil zu unterscheiden ist), schlägt die französische Ökonomin Julia Cagé einen völlig anderen Weg vor: Es bringe genauso wenig, auf Werbungen zu setzen, wie auf staatliche Hilfe in Form von Presseförderung zu bauen.
Cagé fordert ein neues System. Dafür formuliert sie zunächst einige Prämissen: Medien sind für die Demokratie relevant, weil sie zur Meinungsbildung beitragen, gehören also gerettet. Die Wahlbeteiligung sei dort am höchsten, wo Menschen mehrere Meinungen serviert bekämen. Es sei also nicht entscheidend, wie viele Medien es gebe, sondern dass sie ein eigenes Profil hätten. Außerdem gehe es nicht darum, dass Print überlebe, sondern dass die eigenständige Produktion von qualitativ hochwertiger Information erhalten bleiben könne.
Derzeit sieht es nicht so aus. Medienunternehmen, die an der Börse notieren, sparen in der Redaktion, um genügend Rendite abzuwerfen. Laut American Society of News Editors arbeiteten im Jahr 2013 durchschnittlich 27 Journalisten in einer Tageszeitung. Zwölf Jahre zuvor waren es noch zwölf Journalisten mehr pro Zeitung gewesen. Das bedeutet: weniger Leute für die gleiche Arbeit. Die Zeit für Recherche schmilzt.
Die großen Würfe gelingen nur noch Mäzenen. Etwa der Plattform ProPublica, die von Immobilienmilliardären als Stiftung gegründet wurde und mit tiefgehenden Recherchen einige Pulitzerpreise gewann. Oder der investigativen Nachrichtenseite The Intercept von Ebay-Gründer Pierre Omidyar, die Star-Aufdecker wie Glenn Greenwald engagierte. Aber können Milliardäre mithilfe von Stiftungen den Journalismus retten?
Cagé zweifelt daran. Zu groß ist die Gefahr, dass diese die gekauften Medien für die eigene Agenda missbrauchen. Selbst wenn ein Milliardär die besten Absichten hätte: Was geschieht, wenn er stirbt? Zu oft schon haben Erben Medien zugrunde gerichtet.
Die studierte Ökonomin Cagé hat also gute Gründe, in den bereits bekannten Wegweisern aus der Medienkrise ein übermaltes Sackgassenschild zu vermuten. Ihre Lösung ist eine neue Unternehmensform: die nicht gewinnorientierte Mediengesellschaft. Diese soll die Vorzüge von Aktiengesellschaft, Stiftung und Genossenschaft vereinen.
So soll die neue Form wie in einer Stiftung dafür sorgen, dass das zugeführte Kapital im Sinne der Beständigkeit in der Gesellschaft bleibt, anstatt es wie in einer AG in Form von Gewinnen auszuzahlen. Damit Kapital fließt, soll die nicht gewinnorientierte Mediengesellschaft – wie Stiftungen auch – steuerlich begünstigt werden.
Die steuerliche Subvention könnte an die Stelle der Presseförderung treten, die in vielen Ländern ziellos verteilt wird. Wie in einer Aktiengesellschaft sollen viele Menschen die Möglichkeit haben, dem Unternehmen Kapital zuzuschießen. Wie in einer Genossenschaft sollen auch kleine Investoren Mitsprache besitzen.
Wie kann das gelingen? Mit Beteiligungsschwellen will Cagé die Macht der Großaktionäre beschneiden, um die Unabhängigkeit des Mediums zu gewährleisten. Soll heißen: Anders als bei einer AG gelten etwa ab einer Grenze von zehn Prozent die Stimmrechte des Großinvestors nicht mehr proportional zum Kapital. Im Gegenzug sollen Kleininvestoren aufgewertet werden. Sie sollen sich zu einer Lesergesellschaft zusammenschließen können und so ihr Stimmrecht ausüben.
„Es ist nicht bloß erlaubt, zu träumen, es ist notwendig geworden“, schreibt Cagé. Ob ihr Lösungsmodell der Praxis standhält, bleibt vorerst noch offen. Cagé liefert mit ihrem Werk jedenfalls einen wohlüberlegten Beitrag ab, der die Debatte über die Rettung der Medien bereichert.