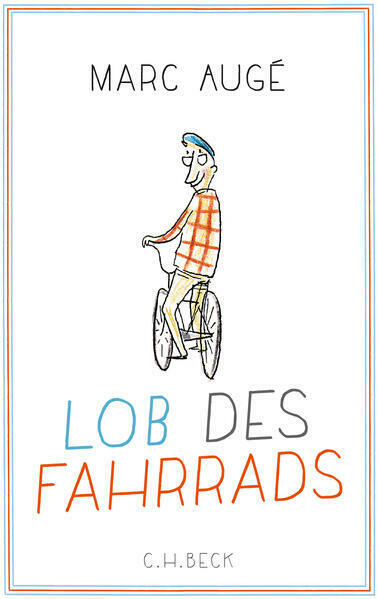Das Fahrrad als ultimatives Vehikel der Freiheit
Julia Kospach in FALTER 11/2016 vom 16.03.2016 (S. 45)
Radfahren: Ein feuriges, von aktuellen Ereignissen überholtes „Lob des Fahrrads“ des Ethnologen Marc Augé
In den großen Ferien, die er bei seinen Großeltern in der Bretagne verbrachte, radelte der junge Marc Augé jeden Nachmittag zum Dorf-Bistro am Kirchplatz. Auf einer Tafel, die dort an der Tür hing, verzeichnete der Wirt täglich gegen vier oder fünf die Namen der Tagesetappensieger und der Führenden im Gesamt-Classement der Tour de France. Nichts interessierte den Halbwüchsigen mehr als die großen Helden des Straßenrennens, das sich nach einer kriegsbedingten Unterbrechung endgültig zu einem der zentralen Mythen der Grande Nation entwickelte.
Marc Augé, Jahrgang 1935, aus dem später der große Ethnologe und Anthropologe werden sollte, war dem Tour-Fieber vollends verfallen. Dass die Franzosen schon seit langem keine Tour-Sieger mehr stellen, erklärt sich der nunmehr in seinem neunten Lebensjahrzehnt angekommene Augé so: „Weil in Frankreich der Mythos zugrunde geht, gewinnen Franzosen keine Rennen mehr, nicht etwa umgekehrt.“
Von den zahllosen Radrennen, die es früher vor allem in Frankreich gab, ist die Tour de France das einzige, das überlebt hat. Allerdings um den Preis der Kommerzialisierung und heute von Dopingskandalen erschüttert. Zeit, das Radfahren neu zu denken bzw. sich auf seine Tugenden zu besinnen. Genau das tut Augé.
Der Mythos schwächelt, das Radfahren ist nicht mehr – wie im Frankreich von Augés Jugend – ein „unverzichtbares Hilfsmittel der in bescheidenen Verhältnissen lebenden Menschen“ und zugleich ultimatives Symbol von deren „Träumen und Fluchten“. Zunehmend in den Bereich von Sport und Freizeit verdrängt, hat es sich zu einem „Bestandteil des sozialen Lebens im dritten Lebensabschnitt“ gewandelt – gleichsam als Beschleunigungsversuch von all jenen, die sich der Illusion des Jungbleibens hingeben wollen.
Doch Augé sieht Hoffnung, auch für Frankreich, wo Radfahrer noch nicht zu einem omnipräsenten Anblick geworden sind. Viel erwartet er sich vom 2007 ins Leben gerufenen Pariser Leihfahrradsystem „Velib“, durch das sich Touristen und Pariser die Stadt vom Rad aus erschließen können. Vielleicht, so Augé, werde diese Initiative Radfahrern in ihrer Funktion als Stadtflaneure Auftrieb geben.
Das Radfahren ist wie geschaffen, den urbanen Menschen neu zu erden. Augé sieht es als Gegenbewegung zu jener Passivität, zu der die Medien täglich einladen. Wer sich in den Sattel schwingt, ist nicht virtuell, sondern ganz im Realen unterwegs, erlebt Schwerelosigkeit und kann spielerisch an Kindheitserinnerungen anknüpfen, da die meisten von uns mit den ersten Radfahrerlebnissen einen tiefen Eindruck von neuer Freiheit verbinden.
Nicht anders ging es Marc Augé als Kind. Deshalb hat der Ethnologe der Alltagsphänomene das Radfahren als Phänomen auch zeitlebens unter Beobachtung gehalten und ihm dieses leidenschaftliche Plädoyer gewidmet. „Lob des Fahrrads“ erscheint erstmals in deutscher Übersetzung. Das Original kam bereits 2008 heraus, und das erweist sich insofern als Problem, als es inzwischen von Ereignissen überholt wurde, die einige seiner schwärmerischen Thesen ziemlich naiv erscheinen lassen.
Beim Lesen sollte man sich deshalb vor Augen halten, dass es mehrere Jahre vor dem Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo im Januar 2015 und vor den Anschlägen von Paris im November 2015 geschrieben wurde. Dann befremdet einen manches weniger. Zum Beispiel das Kapitel, in dem Augé aus der Perspektive des Jahres 2030 Utopien dazu formuliert, welche Veränderungen durch den neuen Fahrradtrend möglich werden könnten: „Schon vor langer Zeit musste der religiöse Fundamentalismus vor dem Fahrrad kapitulieren, und die Fahrradmode hat endgültig auch die wenigen Mädchen befreit, die noch von rückständigen Eltern oder rückwärtsgewandten Brüdern daran gehindert wurden, auf diese teuflische Maschine zu steigen.“
Von einem solchen Befreiungsschlag scheinen wir heute so weit entfernt wie nie zuvor. Der Gedanke vom Rad als Vehikel des Humanismus ist schön – aber dass Augé ihn für das Frankreich von 2016 noch genauso formuliert hätte, darf bezweifelt werden.