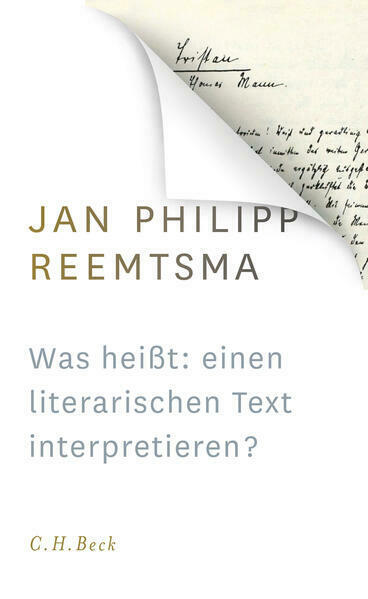Die Klippe Kant und Mörikes Lampe
Thomas Leitner in FALTER 11/2016 vom 16.03.2016 (S. 22)
Von Athen via Weimar nach Frankfurt am Main: Jan Philip Reemtsma spürt in klugen Essays dem literarischen Sinn nach
Jan Philipp Reemtsma, 1952 geboren und Professor für Neuere Deutsche Literatur in seiner Heimatstadt Hamburg, erweckt mit seinem Titel die Hoffnung, nach der Lektüre könne man bessere Rezensionen schreiben – quod esset demonstrandum.
Was dann doch etwas schwieriger als angenommen ist. Denn der rote Faden durch diesen spannenden Text zeigt sich erst nach der ersten, traktathaft formalisierten Einführung: Wer zu anderen über ein Werk sprechen möchte, behauptet damit, es gäbe gute Gründe dafür, Gründe, die im Werk selber oder im „Berichter“ liegen. Die „wittgensteinsche Leiter“ soll man aber nicht ignorieren, man hebe sich diesen Abschnitt eben für das Ende der Lektüre auf.
Reemtsma selber verliert den Faden nicht aus den Augen, schweift aber in mannigfaltiger Weise ab: zur klassischen Antike und Weimarer Klassik etwa. Er berührt die Metapherntheorie der angelsächsischen Sprachphilosophie, knüpft Referenzen zur Frankfurter Schule, zu Vladimir Nabokov und Thomas Mann.
Es wimmelt nur so von Seitenhieben und Hommagen an alles, was an Literatur- und Geistesgeschichte so herein- und beispielt. Am Ende ist man verblüfft, wie viel in knapp 300 Seiten durchlaufen wurde, wie scheinbar Weithergeholtes sich ineinander fügt, wie tief man in eine Theorie des literarischen Sinnes vordringen konnte.
Leichtfüßig, aber ohne oberflächlich zu sein wird etwa der tumbe Rezitator Ion aus dem sokratischen Dialog als Gegenmodell des Interpreten vorgeführt und so nebenbei Philosophiegeschichte betrieben. Reemtsma zeigt, dass die Niederlage der Perser in der Schlacht von Salamis die „Anything goes“-Welle der Sophisten auslöste, dass die „Sophisterei“ seit dem Sieg Spartas im Peloponnesischen Krieg aber als „unseriös“ galt und mitsamt der Demokratie langsam abgeschafft wurde.
Dergleichen kann ziemlich anspruchsvoll werden. Der Versuch, Zustimmung zu einem ästhetischen Werturteil zu erhalten, führt notwendigerweise zu Kants Kritik der Urteilskraft, wo aus dem „interesselosen Wohlgefallen“ ein subjektives Urteil mit Anspruch auf Allgemeinheit abgeleitet wird, die allerdings nicht auf begrifflicher Notwendigkeit beruht.
Über diese Erörterung der Bedingung der Möglichkeit des ästhetischen Urteils hinaus spannt Reemtsma einen Gedankenbogen zur Gesamtarchitektonik der drei kantischen Kritiken. Bezeichnend für die Eleganz seines Stils, dass er aus hochfliegenden und tiefgreifenden Erörterungen mit einer ironischen Volte herausfindet, um nicht „in Erblickung der klammen Formulierung sich schon an dem erhabenen Gedanken zu wärmen“.
Die Auseinandersetzung mit den Texten Kants bleibt die schroffste Bildungsklippe des Buches. Viele der brillanten Essays (manchen merkt man an, dass sie aus einem Vorlesungszyklus entstanden sind) sind aber auch ohne solide Kant-Kenntnisse mit Gewinn zu lesen. Die ausführliche Interpretation von „Herrmann und Dorothea“, dem einst so klassischen und heute (fast) vergessenen Versepos Goethes, ist schon für sich allein dankenswerte Nachhilfe und Bravourstück in einem, lehrreich und vergnüglich. In ihrer Verbindung zu allgemeinen Überlegungen darüber, dass die Weimarer Klassik einen quasi-teleologischen Referenzstandard bilde, wird sie erst recht fruchtbar. Und die Schilderung, wie Emil Staiger und Martin Heidegger sich über eine Lampe bei Mörike in die Haare gerieten, gibt humoristisch eine Ahnung davon, wie es bei einem Methodenstreit zwischen philosophischer und philologischer Gedichtinterpretation zugehen kann.
Über ein so pointiertes wie hochtrabendes Adorno-Diktum bemerkt Reemtsma, mit einem solchen Zitat ließe sich nicht flirten – viele Formulierungen seines Textes hingegen laden gerade dazu ein. Wenn es gelungen ist, den Leser dieser Rezension zu einem solchen Flirt einzuladen, hat sich die eingangs angesprochene Hoffnung erfüllt.
Dem Verlag allerdings kann man einen kleinen Rüffel nicht ersparen: Auf ein Personenregister hätte man angesichts der Fülle an Querverweisen nicht verzichten dürfen.
Jan Philip Reemtsma tritt am 22. April, 20 Uhr im Rahmen des Festivals Literasee im Hotel „Die Wasnerin“ in Bad Aussee auf