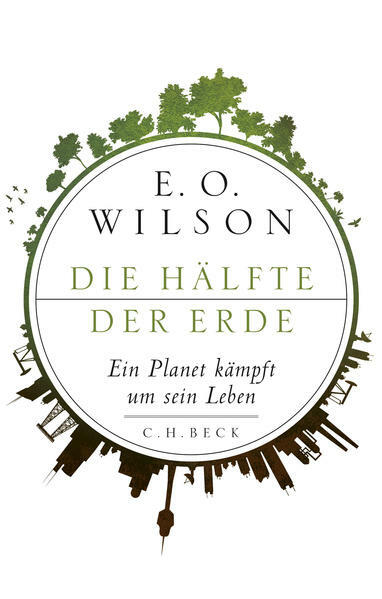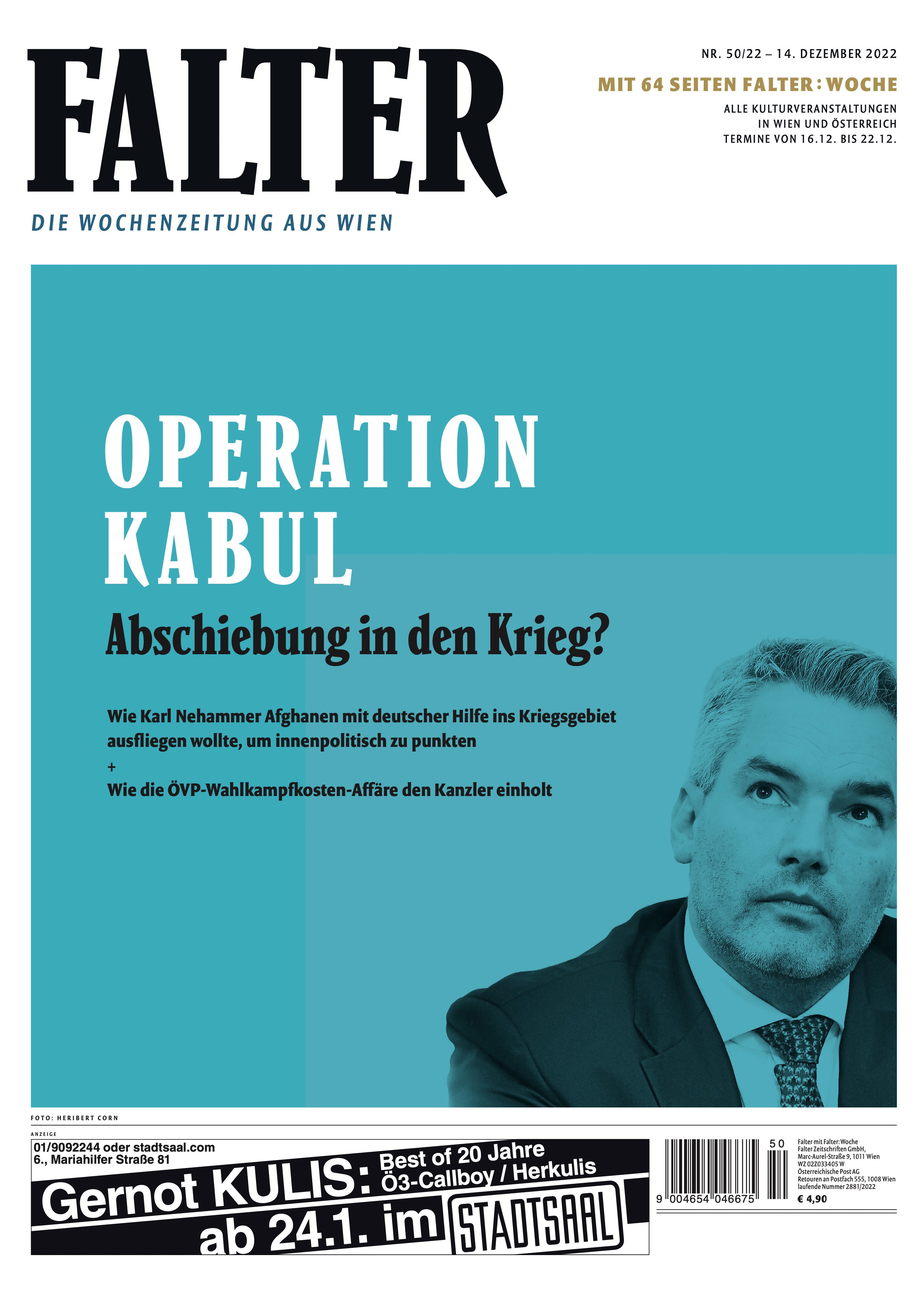
UNTER DER KÄSEGLOCKE
Katharina Kropshofer in FALTER 50/2022 vom 14.12.2022 (S. 50)
Hier gibt es nichts zu sehen. Kein Infoschild mit Beschreibungen der lokalen Flora und Fauna. Kein Häuschen, das den Eingang eines Nationalparks markiert. Nur die rostigen Berge auf dem Areal des lokalen Schrotthändlers und Werbeplakate für die anstehende Niederösterreich-Wahl. Ein Industriegebiet, wie es im Buche steht.
Sie scheint das nicht zu stören: Eine Großtrappe, ein Rehbock und ein Bussard überqueren im Abstand von Sekunden die kleine Straße und verschwinden in der Böschung, dort, wo der Weidenbach auf einen kleinen Schilfgürtel trifft.
Gänserndorf wächst. Die Sulzgrabenmündung hier ist ein wichtiges Erholungsgebiet -für den Menschen, aber auch für Schilfrohrsänger und Grünfrosch, Großtrappe, Biber und die Gebänderte Prachtlibelle. Doch geschützt ist das neun Hektar große Gebiet nicht. Man könnte also die Arten hier zählen, messen, wie vielfältig dieser Ort ist, Dokumente sammeln, um ein neues Naturschutzgebiet ausweisen zu lassen. "Die Frage ist, ob das notwendig ist", sagt Thomas Zuna-Kratky, Biologe im Büro für Landschaftsplanung und Experte für das Marchfeld und seine Tiere.
Ob es für Ökosysteme und ihre Arten immer besser ist, einen Schutzstatus zu haben, darüber streitet die Wissenschaft. Der Landschaftspark Sulzgrabenmündung steht deshalb für eine große Frage: Wie viel Raum geben wir der Natur? Sollen wir sie vor menschlichem Einfluss schützen? Oder wäre es besser, unsere Umwelt naturnäher zu gestalten, ihren Wert in Gebieten wie hier in Gänserndorf zu sehen und so einfach in jedem Bereich mitzudenken?
Gerade wird diese Frage auf mehreren Bühnen heiß diskutiert: Auf der Weltnaturschutzkonferenz im kanadischen Montreal ringen seit 7. Dezember rund 5000 Delegierte aus 193 Ländern um ein neues Artenschutzabkommen. Und insbesondere um ein Ziel: 30 mal 30, also 30 Prozent der Weltfläche bis 2030 unter Schutz zu stellen, zehn Prozent davon streng zu schützen.
Österreich zählt sich zur "High Ambition Coalition", also jener Gruppe von Staaten, die dieses Ziel vorantreiben will. Bis 2030 sollen 30 Prozent der Landesfläche unter Schutz stehen, ein Drittel der Arten auf der Roten Liste nicht mehr gefährdet, 35 Prozent der Landwirtschaft auf Bio umgestellt sein. So steht es in der lange ersehnten österreichischen Biodiversitätsstrategie 2030+, die Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag veröffentlichte. Sie reist nun nicht mehr mit leeren Händen zur Weltnaturschutzkonferenz nach Montreal.
Mehrmals wurde diese bereits verschoben, weil das eigentliche Gastgeberland China an seiner Zero-Covid-Politik festhielt und Konferenzen unmöglich wurden. Für eine Einigung in Kanada ist es also höchste Zeit: Das neue Abkommen soll nicht weniger als das sechste Massenaussterben aufhalten. Weltweit sind nur noch fünf Prozent der Wälder intakt, nur drei Prozent der Weltmeere von Menschen unberührt. Eine Million der beschriebenen acht Millionen Arten könnten laut dem Weltbiodiversitätsrat IPBES in den nächsten Jahrzehnten aussterben, den Afrikanischen Elefanten könnte es zum Beispiel schon 2040 nur noch in Zoos geben.
Es geht aber nicht nur um die Natur. Auch Menschen brauchen Bestäuber für Pflanzen, die Ernten sichern, Flüsse und Seen im Gleichgewicht, die Trinkwasser garantieren, Wälder, die Lawinen oder Muren aufhalten -Leistungen, die nur intakte Ökosysteme bereitstellen können.
Das Schicksal der gesamten lebenden Welt stehe auf dem Spiel, so schreiben es drei Forschende in der Fachzeitschrift Science, die unter anderem an der Columbia University in New York forschen. Inger Andersen, die Chefin der Uno-Umweltorganisation, bezeichnet die verursachenden Faktoren -Umweltverschmutzung, Landnutzungsänderungen, Raubbau, die Klimakrise und die Ausbreitung invasiver Arten - als die "fünf Reiter der Apokalypse".
Nicht umsonst nennen also Wissenschaftler die Biodiversitätskrise die Zwillingskrise zur Klimakrise. Nicht umsonst könnte die Konferenz eine Zeitenwende einläuten, das angestrebte Abkommen wirkt wie ein längst überfälliger Beschluss. Wie die Hoffnung, doch noch eine Systemwende einzuleiten, Regenwälder und Auen, Korallenriffe und Hochgebirge besser zu schützen oder besser gesagt: vor dem Menschen zu schützen.
Am besten, man lässt diesen überhaupt ganz weg. Zumindest von einer Erdhälfte. So argumentierte der berühmte, kürzlich verstorbene US-amerikanische Biologe Edward O. Wilson in seiner Half-Earth-Theorie: Um die natürlichen Prozesse - Evolution, die Erhaltung der Biosphäre -aufrechtzuerhalten, müsse man die Hälfte des Planeten komplett aus der Nutzung nehmen. Der Mensch hätte dann noch die andere Hälfte Platz für seine (intensive) Lebensweise. Zahlreiche Forscherinnen und Forscher, Naturschützer und Intellektuelle schlossen sich diesem Konzept an.
Auch Harald Meimberg, Leiter des Instituts für Integrative Naturschutzforschung an der Universität für Bodenkultur, kann damit viel anfangen: "Wir wissen nicht, ob wir die andere Hälfte dann komplett übernutzen würden, die geschützte Hälfte vielleicht nicht ganz intakt bleibt. Aber was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass sie auf keinen Fall intakt bleibt, wenn wir es nicht versuchen."
Das Half-Earth-Konzept sei also eine Art Vorsorgeprinzip, das momentan noch komplett ignoriert wird. Obwohl Forscher bereits berechneten, dass wir die derzeitige Weltbevölkerung ernähren könnten, auch wenn 40 - nicht 50 -Prozent der Fläche außer Nutzung stünden.
Ob 50,40 oder 30 Prozent -viele Beispiele zeigen, dass das In-Ruhe-Lassen sinnvoll sein kann: Erst im Oktober beschrieben Forschende im Fachjournal Science die positiven Effekte der zweitgrößten "no-fishing zone", die vor der Küste Hawaiis liegt. Nicht nur erholten sich Fische, Korallen und Krebsarten innerhalb der 1,5 Millionen geschützten Quadratkilometer; auch die Zahl der Thunfische, die entlang der Zone migrierten, nahm zu: Die erholten Fischbestände schwammen aus der geschützten Zone, die Thunfische außerhalb fanden mehr zu fressen.
An Land gilt Ähnliches: Erholen sich Insektenbestände, sind das nicht nur gute Nachrichten für uns, weil wir sie als Bestäuber brauchen. Auch die stark bedrohte Vogelwelt profitiert, Insekten dienen ihr als Futterquelle.
Was die Schutzgebiete angeht, sieht sich Österreich als Vorreiter. Das geht zumindest aus der frisch veröffentlichten Biodiversitätsstrategie hervor. Stand Dezember 2020 gelten darin 29 Prozent der Fläche als geschützt. Hat das Land das 30-Prozent-Schutzziel -das eigene und das der Uno-Artenschutzkonferenz -also schon erreicht?
Etwas komplizierter ist es dann doch: Streng geschützt, also als Nationalparks oder Wildnisgebiete (die weitestgehend ohne menschlichen Einfluss bestehen), sind nur rund drei Prozent der Staatsfläche; 14 Prozent sind gut geschützt, als Natura-2000-Gebiete zum Beispiel; weitere zwölf Prozent nur gering, unter anderem als sogenannte Landschaftsschutzgebiete. "Die zielen lediglich darauf ab, den Charakter der Landschaft nicht groß zu verändern", sagt Franz Essl, "das ist aber nicht zwangsläufig Naturschutz."
Essl lehrt am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Uni Wien, zählt zu den meistzitierten Wissenschaftlern des Landes und zum Leitungsteam des österreichischen Biodiversitätsrats -einer unabhängigen Vereinigung von Experten zum Thema Artenvielfalt. Die 29 Prozent könne man fachlich so nicht stehen lassen.
Quantität sagt nicht unbedingt etwas über Qualität aus. Das gilt auch für Natura-2000-Gebiete, die auf Europarecht basieren: 15 Prozent der Landesfläche fallen in Österreich in diese Kategorie, das liegt unter dem EU-Durchschnitt von 19,6 Prozent.
Seit September läuft ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich: Die EU-Naturschutzvorschriften werden in Österreich zu schlecht umgesetzt, heißt es in einem Brief der EU-Kommission. "Da steht vielleicht ein Taferl davor, aber eigentlich ist seit Jahrzehnten - salopp gesagt -nix passiert", sagt Essl. Kommt es zu einer Verurteilung, müsste das Land Millionen Euro an Strafe zahlen.
Die Frage, wie viel Fläche der Mensch nun abgeben soll, um die auch für ihn essenziellen Funktionen der natürlichen Welt aufrechtzuerhalten, ist also alles andere als ein Zahlenspiel. Nur 30 Prozent des Amazonasgebiets, des Hotspots der globalen Biodiversität, zu schützen wäre etwa sinnlos. 80 Prozent braucht es, damit es nicht "kippt", sich nicht in eine Savanne verwandelt. 17 Prozent sind bereits abgeholzt.
Festungsnaturschutz zu betreiben, also einen symbolischen Stacheldraht um Gebiete zu ziehen, kann wiederum indigenen Völkern schaden: "Das wären grobe Menschenrechtsverletzungen", sagt Ursula Bittner von Greenpeace. "Wir wissen, dass viele biodiverse Hotspots überhaupt erst von Indigenen gemanagt werden."
Und dann ist da noch die Kernfrage: Wie genau soll man diese 50,40 oder 30 Prozent der Erde überhaupt schützen? Soll man sie ganz in Ruhe lassen? Und was passiert mit dem Rest? Schutzgebiete sieht Arno Aschauer vom WWF als Rückgrat für den Erhalt von Ökosystemen. Aber: "Es reicht nicht, eine Art Disneyland zu erhalten und auf den restlichen 70 Prozent einfach nichts zu machen", sagt er. Ohne strenge Bestimmungen wäre der Rest der Landschaft zum Abschuss freigegeben.
Die Gänserndorfer Sulzgrabenmündung wäre jedenfalls nicht Teil des Prozentsatzes. Die Fläche haben Naturschützer trotzdem auf eine Liste aufgenommen: 140 Kleinode in 54 Orten der Region Marchfeld fanden die Experten unter der Leitung von Thomas Zuna-Kratky, der anliegende Nationalpark Donauauen hatte die Studie in Auftrag gegeben. Manche Standorte mit, manche ohne Schutzstatus.
Eine alte Eiche etwa, mit vielen Mikrohabitaten, also Löchern und Behausungen für Tiere; lehmige Hänge, an denen der Eisvogel brüten kann; oder der Weingarten Lassee: Hier bauten die Gänserndorfer vergangenes Jahrhundert Wein an, heu te ist der unscheinbare, sandige Hügel ein wertvoller Trockenrasen. Würden hier keine Schafe weiden, könnten sehr schnell Büsche wachsen und dadurch seltene Pflanzenarten wie die Kuhschelle, angepasst an die kargen Bedingungen, verlorengehen. Würden Freiwillige nicht regelmäßig ausrücken, um Robinien zurückzuschneiden, würde die invasive Art bald alles überwuchern. "Dann sind alle Dinge, die den Trockenrasen besonders machen, weg", sagt der Biologe Zuna-Kratky.
Das Projekt soll also vielmehr die besonderen Orte in jeder Gemeinde aufzeigen - ganz abgesehen von ihrem Schutzstatus. Dazu kommt, dass diese kleinen Rückzugsorte als Trittsteine gelten, die strenger geschützte Gebiete verbinden. Denn gerade zwischen den intensiv bewirtschafteten Zwiebeläckern braucht es Rückzugsorte. Etwa für Vögel wie die Großtrappe.
Rainer Raab hat dem Vogel die Hälfte seines Lebens gewidmet. "Er ist ein Paradebeispiel für einen Vogel, der mit der Agrarindustrie nicht zurande kommt", sagt der Leiter eines Technischen Büros für Biologie in Deutsch-Wagram. Zwei Eier legt die Großtrappe im Durchschnitt, brütet dafür auf dem Acker. Wird dort gespritzt, haben die Jungtiere ein Problem: 1000 Insekten muss ein einziges Küken pro Tag fressen. Und die findet es nur auf wenig genutzten Flächen, etwa Brachen.
Die Großtrappe ist also ein Beispiel für eine Erfolgsgeschichte jenseits streng geschützter Gebiete, für Naturschutz nach Vertrag: Nur noch 60 bis 70 Individuen gab es Mitte der 1990er-Jahre in ganz Österreich, im burgenländischen Heideboden überhaupt nur noch 20. Also startete Raab dort ein Projekt, um die Population im Marchfeld wieder zurückzubringen: Landwirte bekommen Entschädigungen, wenn sie vor der Brutzeit Mitte April aufhören zu spritzen. Eine Art Ertragsentgang. Die Taktik ging auf.
Heute gibt es 600 Individuen, die großteils in Österreich, aber auch in Teilen Ungarns und der Slowakei brüten. 700 Landwirte, 200 Jäger, zahlreiche Bürgermeister und Gemeinden sind Unterstützer des Trappenschutzprojekts. Selbst das Etikett des berühmtesten Weins der Gegend, Heideboden, ziert der Vogel stolz. "Wir können nicht alles streng schützen, dafür hat der Mensch schon viel zu stark eingegriffen", sagt Raab. "Wir müssen auch innerhalb der Kulturlandschaft Biodiversität erhalten."
Was also braucht es? Mehr unberührte Urwälder oder Naturschutz, der versucht, die Interessen von Mensch und anderen Arten zu vereinen? Beides, sagen die Experten.
Ausweiten könnte man die österreichischen Schutzflächen vor allem in hohen Lagen. Das Karwendelgebirge nördlich von Innsbruck etwa, mit 739 Quadratkilometern das größte Tiroler Schutzgebiet, hat schon jetzt viele unberührte Waldflächen und Wildflüsse, bedeutende Arten wie den Steinadler oder den Frauenschuh, eine bedrohte Orchideenart. Es könnte neben Dürrenstein-Lassingtal und den Sulzbachtälern im Salzburger Pinzgau das dritte Wildnisgebiet des Landes werden.
Doch selbst in streng geschützten Gebieten müssen zumindest Randzonen gemanagt werden, um sie etwa von invasiven Arten zu befreien, gegen die viele bedrohte heimische Arten keine Chance hätten. "In Österreich ist viel von der wertvollen, artenreichen Landschaft eine Kulturlandschaft, die über Jahrhunderte entstanden ist", sagt Biodiversitätsforscher Essl. Oder kurz gesagt: Der Mensch hat bereits so viel Einfluss auf die Welt, dass eine Welt ohne seinen Einfluss nicht mehr möglich ist.
Wozu ist denn diese ganze Artenvielfalt gut?
Peter Iwaniewicz in FALTER 41/2016 vom 12.10.2016 (S. 39)
Ökologie: Edward O. Wilson legt einen wütenden Kassandraruf zur Rettung des Ökosystems Erde vor
Edward Wilson ist wütend. Aber er ist nicht nur das, sondern auch einer der weltweit renommiertesten Biologen, Pulitzerpreisträger für zwei seiner Sachbücher, und er führte in den 1980er-Jahren den Begriff Biodiversität in die wissenschaftliche Diskussion ein. Mit seinen Studien schuf er die theoretischen Grundlagen zur Erforschung der biologischen Vielfalt.
Was macht aber einen so prominenten Wissenschaftler so schlecht gelaunt? Seit einigen Jahren beschreibt er in auflagenstarken Büchern, wie der Mensch zum Architekten und Beherrscher des Planeten wurde und welche Folgen dies für alle anderen Lebewesen auf der Erde hat.
In seinem ersten Band einer thematischen Trilogie zu diesem Thema, „Die soziale Eroberung der Erde“ (2013), zeigte er auf, warum es im Tierreich nur sehr selten zu komplexer sozialer Organisation gekommen ist und welche Voraussetzungen notwendig waren, dass sich dieses Phänomen bei einer bestimmten großwüchsigen Primatenart in Afrika herausbilden konnte.
In einem weiteren Buch, „Der Sinn des menschlichen Lebens“ (2015), befasste er sich mit der Frage, warum unser verhältnismäßig leistungsschwaches Sinnessystem und das daraus resultierende moralische Denken den Herausforderungen unserer modernen menschlichen Gesellschaft nicht mehr gewachsen ist.
Das nun vorliegende dritte Werk ist der abschließende und flammende Appell, die fantastische Vielfalt an Lebensformen unserer Welt dadurch zu retten, das wir die „Hälfte der Erde“, so auch der wegweisende Titel, der Natur überlassen. Seinen für viele wahrscheinlich radikalen Ansatz sieht er selbst allerdings nur als Notlösung, die der Größe des Problems angemessen ist.
Mit seinen Kassandrarufen ist Wilson weder der erste noch der einzige Warner vor der biologischen Apokalypse. Aber es wäre falsch, ihn nur als eine Art Öko-Wutbürger zu verstehen. Dazu sind seine Befunde und Analysen zu faktenorientiert, zu umfassend und zu brillant geschrieben.
Raffiniert lockt er den anfänglich noch spröden Leser an und stellt die provozierende Frage, wie viele Arten selbst aus Sicht eines engagierten Naturschützers aussterben sollten: Parasitierende Würmer, krankheitsübertragende, blutsaugende Insekten, darauf kann man sich schnell einigen.
Hochgerechnet kommt Wilson auf deutlich unter tausend Spezies, die aus Sicht der Menschheit ausgerottet werden dürften. Und dann rechnet er vor, wie viele Arten wir wie schnell tatsächlich auslöschen: Vor dem Aufkommen des Homo sapiens pro Jahr maximal eine pro Million existierender Arten, heute nach der Berechnung von Experten drei bis 130 Arten pro Tag. Ein Faktor, der hundert- bis tausendfach bis über dem natürlichen Wert liegt.
Zum Glück vergisst Wilson nicht gelegentlich auch Befunde anzuführen, die zumindest zarten Grund zur Hoffnung geben, dass die belebte Welt doch noch nicht völlig in Schutt und Asche liegt: Von den 25.780 bekannten Arten von Landwirbeltieren ist ein Fünftel vom Aussterben bedroht. Wiederum ein Fünftel davon konnte infolge von Maßnahmen des Umwelt- und Artenschutzes in den letzten Jahren aus der unmittelbaren Gefährdungsstufe geholt werden.
Auch bei den Vögeln wurde das Artensterben in den vergangenen 100 Jahren um die Hälfte verringert. Konkret konnten so bis heute 31 gefährdete Vogelarten am Leben erhalten werden. Schön, kann man da als ignoranter Mensch sagen, und die provokante Frage stellen, wozu denn diese ganze Artenvielfalt gut sei. Oder würden uns die relativ wenigen domestizierten Tier- und Pflanzenarten, die wir für Nahrung und Kleidung brauchen, nicht auch schon für ein gutes Leben reichen?
Auch hier ist Wilson schnell mit guten Argumenten und Beispielen zur Stelle. In vernetzten Ökosystemen sind die Auswirkungen der Arten aufeinander im Voraus kaum abschätzbar. Was passiert, wenn ein Glied dieser Nahrungsketten ausfällt? So seltsam es sich auch anhört, aber die Populationsdichte von Wölfen hat einen direkten Einfluss auf das Baumwachstum im Wald.
Im Yellowstone-Nationalpark senkt die Anwesenheit eines kleinen Wolfsrudels sehr deutlich die Anzahl von Elchen in diesem Gebiet. Ein Wolf kann einen ganzen Elch innerhalb einer Woche fast vollständig fressen. Der Elch wiederum ernährt sich bevorzugt von großen Mengen junger Baumkeimlinge. Oft vertreibt allein die geruchliche Anwesenheit von Wölfen diese Pflanzenfresser. Die Ausdehnung des Waldes und das Vorkommen von Wölfen stehen somit in direktem Zusammenhang.
Im Nachhinein betrachtet klingt das alles sehr logisch und wenig überraschend. Überraschend ist nur, dass dieser ökosystemare Zusammenhang erst vor einigen Jahren aufgeklärt wurde. Trotz wissenschaftlicher Forschung sind viele Fragen über solche Wechselwirkungen noch völlig ungeklärt.
Lesenswert und kurzweilig führt uns Wilson die gravierenden Probleme des Artensterbens vor Augen und konfrontiert die Leser mit jenen unbequemen Wahrheiten, die man zwar gerne ausblendet, die aber schneller, als wir damit rechnen, zu großen globalen Problemen führen werden.
Altersweise ist Wilson, Jahrgang 1929, altersmild hingegen sicher nicht. Im Vorwort schreibt er: „Unterdessen leben wir auf schockierende Wiese willenlos vor uns hin und haben kein anderes Ziel im Kopf als Wirtschaftswachstum, ungehemmten Konsum, Gesundheit und persönliches Glück. Die Umweltbilanz all dieser Aktivitäten ist freilich negativ, die Biosphäre wird labil und unsere langfristige Zukunft immer ungewisser.“
Und das macht nicht nur Edward Wilson wütend.