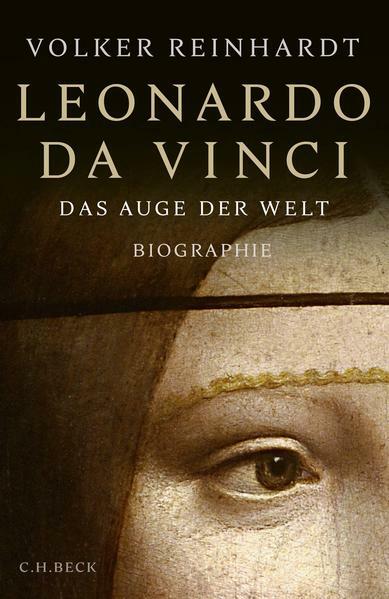Hermelin mit Dame und ein lasziver Johannes
Thomas Leitner in FALTER 41/2018 vom 10.10.2018 (S. 51)
Biografie: Volker Reinhardt zeigt den Ausnahmekünstler Leonardo da Vinci (1452–1519) in einem neuen Licht
Familien wie die Borgia, Päpste wie Pius II., Reformer wie Calvin und Luther, Philosophen wie Machiavelli und Künstler wie Michelangelo: Volker Reinhardt veröffentlichte seit 2002 fast jedes Jahr einen gewichtigen Band über die Renaissance. Die Kapitel über die obersten Kirchenfürsten dieser Zeit bilden einen Höhepunkt in seinem letzten Buch „Pontifex. Die Geschichte der Päpste“ (2017).
Nun, zum 500. Todestag, ist Leonardo da Vinci an der Reihe. Dass Reinhardt sich jetzt erst dem rätselhaftesten, von Mythen und immer neuen Deutungen umrankten Künstler der Renaissance annähert und ihn in ein geradezu provokativ neues Licht stellt, lässt die bisherigen Werke fast wie Vorbereitungen zum fesselnden Porträt des tief in die kulturelle und politische Umwelt verstrickten großen Außenseiters wirken.
Mit allem, was zum guten Ton seiner Zeit gehörte, lag Leonardo im Widerstreit, Humanisten und Dichtern misstraute er, sah in ihnen die Vertreter einer leeren Bildungshuberei. Aufgrund seiner unehelichen Geburt war ihm keine höhere Bildung zuteil geworden – daraus resultiert, wenn man so will, ein Minderwertigkeitskomplex, der sein Leben bestimmte.
Die hoch angesehenen Alchemisten verachtete er. Sein größtes Anliegen war die rationale Erfassung der Kräfte der Natur. Wie er es mit der Religion hielt, blieb den Zeitgenossen verborgen. Die Homosexualität spielte im Vergleich zu den gesellschaftlichen Konflikten eine eher untergeordnete Rolle.
Mehr Anstoß erregte er sein Leben lang dadurch, wie er mit seinen Auftraggebern umsprang, selbst wenn es sich um Cosimo da Medici in Florenz oder Lodovico il Moro in Mailand handelte. Oft vollendete er die bestellten Werke nicht, veränderte großzügig die Sujets, verwendete andere als die, wie zu dieser Zeit üblich, vertraglich vereinbarten Farben. Oder er führte den Auftrag gar nicht aus, wie das Porträt der Eleonora d’Este, der berühmtesten Kunstsammlerin Italiens. So wurde nach und nach aus dem jungen Wilden ein schwieriger Alter. Seinem letzten Dienstherrn, dem französischen König Franz I., genügte die bloße Anwesenheit der schon zu Lebzeiten legendär gewordenen Künstlerpersönlichkeit an seinem Hof, die allein dafür großzügig bezahlt wurde. Giorgio Vasari, der Chronist der Renaissance und selbst ein mittelmäßiger, aber umso fleißigerer Maler, zeichnet das Bild Leonardos als verschlamptes Genie. Der aber hatte ganz anderes im Sinn als der gefällige Dekorateur und Geschichtenerzähler Vasari.
Was man nicht malen könne, könne man nicht verstehen, lautete sein Credo. Die Malerei sah er deswegen nicht als Handwerk an, sondern als Philosophie und Welterkenntnis, die weit über der konventionell als erste der Künste angesehenen Dichtung stand. Danach kam für Leonardo die Musik – für den Hof verbesserte und entwarf er Instrumente. Dahinter rangierte die Bildhauerei, bei der man sich beschmutzte – ein gezielter Seitenhieb auf seinen größten Konkurrenten Michelangelo. Und ganz am Schluss rangierte die Poeterei …
Wenn der Maler zum „Auge der Welt“ mutiert – so lautet Untertitel dieser Biografie –, wird die Bemühung um klassische Schönheit eitel. Das vollendete Werk tritt hinter das für sich sprechende Detail zurück, und „non finito“ bedeutet keinen Makel mehr: ein Grund dafür, dass viele von Leonardos ohnehin nicht sehr zahlreichen Gemälden unvollendet blieben, er sie nicht veräußerte. Am liebsten hätte er wohl ein Leben lang an ihnen weitergearbeitet – erst beim späten Cézanne begegnet man dieser Haltung wieder.
Natur sieht Leonardo als ein Kontinuum vom Stein bis zum Menschen. Deswegen ist der landschaftliche Hintergrund oft wichtiger als die Figuren und ihre Geschichten, selbst in einem eleganten Porträt wie dem der Favoritin des Mailänder Herrschers steht ein emblematisches Tier so im Vordergrund, dass es eigentlich „Hermelin mit Dame“ heißen sollte statt umgekehrt. Natur ist ewig, vergänglich ist der Mensch, ja das Menschengeschlecht. Das steht im Widerspruch zum Christentum.
Bei Skizzen von zerstörerischen Wind- und Wellenspielen kann man sich des Verdachts nicht erwehren, dass ein Ende des Humanen nicht ohne klammheimliche Freude antizipiert wird.
Aus den Tagebüchern, die die Hauptquelle Reinhardts bilden, spricht eine materialistische Sicht der Welt. Auch aus Leonardos religiösen Gemälden kann keine christliche Erbauung abgeleitet werden: Das „Abendmahl“ erwähnt höchst beiläufig die Einsetzung des Sakraments, im Zentrum steht Verrat, das Rätselraten um den Verräter, die Enttäuschung des Opfers.
In „Anna Selbdritt“, das im Wiener Kunsthistorischen Museum zu bewundern ist, gelingt es den zwei Frauen nur mühsam, den ungebärdigen Jesusknaben davon abzuhalten, dem Lamm den Hals zu brechen. Eine Darstellung des Johannes ist so rätselhaft lasziv, dass ihn eine frömmelnde Favoritin Ludwigs XIV. über 100 Jahre später nur durch Retuschen in einen Bacchus verwandelt ertragen kann. Ein Glück für Leonardo, dass er in einem Milieu lebte, in dem Inquisition und kirchliche Kontrolle nicht so ausgeprägt waren wie im darauf folgenden katholischen Zeitalter des Barock.
Reinhardt widmet sich natürlich auch anderen Facetten des „Universalgenies“ und den wechselnden Gründen für seine Verehrung, zunächst als Malerfürst, dann als Gründer der Naturwissenschaften, als faustischer Alchemist und Erfinder. Dass der Ausnahmekünstler mit seiner Zeit unversöhnt bleibt, macht er auch daran fest, dass Leonardo die der Natur abgetrotzten Geheimnisse hinter dem Lächeln der „Mona Lisa“ versteckt und so im Verborgenen hält.