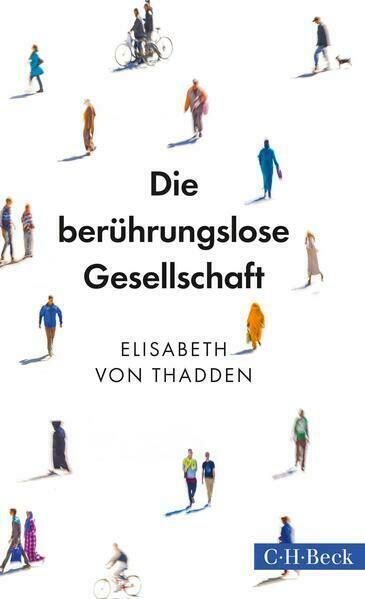Streicheln wir bald pelzige Roboter?
Juliane Fischer in FALTER 41/2018 vom 10.10.2018 (S. 46)
Soziologie: Elisabeth von Thadden untersucht, was Berührungen in unserer Gesellschaft bedeuten
Schon allein unser Wortschatz zeigt die hohe Relevanz des Tastsinns. Etwas ist „in Reichweite“, „zum Greifen nah“, „unantastbar“. Man hält sich etwas „vom Leibe“, wird „handgreiflich“ oder „übergriffig“. Wenn uns etwas „unter die Haut geht“, zeigt das, dass auch Gefühle etwas mit der Berührung bzw. Verletzung unserer Körperoberfläche zu tun haben, zumindest symbolisch.
Erstaunlicherweise ist der Tastsinn vergleichsweise wenig erforscht. Dabei hielt schon Aristoteles fest, dass er der einzige Sinn sei, ohne den der Mensch nicht überleben könne. Ohne Berührung anderer gehen wir zugrunde. Wir brauchen sie, um uns unserer Existenz sicher zu sein. Die Biochemie einer Hautberührung lässt sich durch nichts virtuell stimulieren, gleichzeitig ist das Handy stets griffbereit und inzwischen für viele zu einer Art Sinnesorgan geworden.
Ist unser Leben im Zeitalter der Digitalisierung, der Welt der glatten Oberflächen bald ganz entkörperlicht?, fragt sich Elisabeth von Thadden, Redakteurin der Zeit, in ihrem Buch „Die berührungslose Gesellschaft“. Sie untersucht das Thema von allen Seiten, befragt Psychiater, Neurologen, Islamexperten, Sexualwissenschaftler, eine Soziologin, eine Dermatologin, eine Immobilienwirtschaftsexpertin und eine Heilpraktikerin. Es geht um unverletzliche Freiheiten, Freiwilligkeit und (sexuelle) Selbstbestimmung, Offenheit, Abstumpfung und um Einsamkeit, jene Befindlichkeit, für oder vielmehr gegen die die britische Premierministerin Theresa May Anfang des Jahres eine eigene Ministerin eingesetzt hat.
Fest steht nämlich: Der Umgang mit Nähe und Distanz ist in jeder Kultur anders. Während in Puerto Rico Einheimische während eines einstündigen Gesprächs in einem Lokal etwa 180 Berührungen austauschen, sind es in Frankreich bereits in einer halben Stunde 110 Berührungen – und in den USA in der gleichen Zeit nur zwei. By the way: Angeblich gibt’s mehr Trinkgeld, wenn die Bedienung den Gast leicht beiläufig streift. Wenn von Thadden beschreibt, was Berührungen können, wem sie schaden und wie sie in Haptikforschung, Robotik und politischer Philosophie behandelt werden, bleibt sie im Stil kühl und sachlich. Unermüdlich sammelt sie Fakten und durchforstet Quellen wie etwa Gesetzestexte. Letztlich ist aber schwer erkennbar, worauf sie hinauswill, welche Schlüsse sie zieht, wofür sie plädiert.
Sie ertastet jeden Winkel, der auch nur annähernd irgendwas mit ihrem Thema zu tun hat. Im Kapitel zu Politik und Recht konzentriert sie sich stark auf die Zeit der Aufklärung („Nichts kann gedacht werden, was nicht zuvor gespürt worden ist“), in der Kunst auf die Empfindsamkeit: Goethes Herzschmerz, Diderots Innigkeitsutopie und Mozarts „Hochzeit des Figaro“ werden als Gründungsdokumente moderner Körperverhältnisse definiert. So wird zwar der epochale Wandel am Schauplatz Körper im Rückblick begreifbar, die Bezüge zu aktuellen Debatten rund um die Kölner Silvesternacht und #MeToo werden allerdings nur angedeutet.
Von Thadden widmet sich auch der räumlichen Dichte: Single-Wohnung statt Generationenverband, Flüchtlingslager und Wohnprojekte. Was macht die Großstadt mit uns? Werden wir immer älter, aber sind uns aber trotz aller Egozentrik unserer Existenz nicht bewusst, weil wir nichts und niemanden mehr spüren? Streicheln wir bald pelzige Roboter, weil uns der Körperkontakt im Alter fehlt? Gehen wir bald nicht mehr zum Arzt, sondern zur Schmerzen-Evaluierungs-App und nebenbei auf Kuschelpartys? Nur andere Menschen oder Lebewesen versichern uns im körperlichen Kontakt, dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind – das ist dann doch so etwas wie ein Ergebnis oder vielmehr eine Warnung, die von Thadden aus ihren Gesprächen mit Experten herauskitzelt.