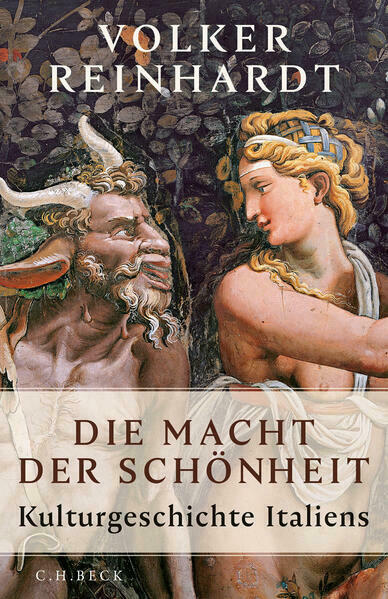Venedig, Verdi und die Vespa
Oliver Hochadel in FALTER 41/2019 vom 09.10.2019 (S. 43)
Kulturgeschichte: Volker Reinhardt liefert eine monumentale Geschichte der Italianità in Schlaglichtern
Volker Reinhardt ist ein erstaunlich produktiver Autor. Abgesehen von seinen Fachpublikationen hat der Historiker an der Universität Freiburg (Schweiz) in den letzten zwei Jahrzehnten im Schnitt etwa ein populärwissenschaftliches Buch pro Jahr veröffentlicht. Die meisten beschäftigen sich mit der italienischen Renaissance, darunter Biografien von Päpsten, Denkern und Künstlern. „Die Macht der Schönheit“ ist hingegen keine Fallstudie, sondern ein Überblickswerk. „Kulturgeschichte Italiens“ lautet der gleichermaßen lapidare wie ambitionierte Untertitel dieses 651-Seiten-Wälzers.
Das erste von 66 Kapiteln handelt von der Cappella Palatino in Palermo, deren prächtige Mosaiken aus dem 12. Jahrhundert die Herrschaft der Normannen in Sizilien visuell legitimieren sollten. Am Ende finden sich Texte über Fiat, Fußball und Federico Fellini.
Worin besteht die Italianità, das besondere Wesen dieser kulturellen Produktion, die in vielem stilbildend war und weit über Italien hinaus wirkte, lautet Reinhardts Leitfrage dabei. Aber wie lässt sich fast ein Jahrtausend Kulturgeschichte überhaupt erzählen, zumal in einem soziopolitisch so heterogenen Gebilde wie „Italien“, dass erst 1861 zu einem Nationalstaat wurde? Reinhardt wählt die Form des Schlaglichtes, keines der Kapitel ist länger als zehn Seiten. Diese lockere Aneinanderreihung entlastet sowohl den Autor als auch den Leser. Ersterer muss keine durchgehende Geschichte erzählen. Und Letzterer fühlt sich nicht verpflichtet, den Ziegel von vorne bis hinten durchzulesen, sondern springt nach Lust und Laune vom Mittelalter auch schon mal vor zu den erotischen Wandmalereien im Palazzo del Tè in Mantua (16. Jahrhundert), zu Vivaldi und Casanova (18. Jahrhundert) oder zum Film „La Dolce Vita“ von 1960.
Die meisten Kapitel beginnen mit der Beschreibung eines Werks – im weitesten Sinne. Häufig ist der Ausgangpunkt ein Gemälde, ein Fresko, ein Mosaik oder eine Skulptur. Auch Musik, die Opern von Monteverdi und Verdi, und Literatur sind vertreten. Dantes „Divina Commedia“ (1320) und Tomasi di Lampedusas „Il Gattopardo“ (der postum 1958 erschien) etwa werden vorzüglich historisiert und erklärt. Seine Beschäftigung mit Architektur – von Pisas marmorweißem Dom über die Palladio-Villen im Veneto, der Spanischen Treppe in Rom bis hin zum ersten Turiner Wolkenkratzer – erlaubt Einblicke in die sich wandelnden Dynamiken der Macht.
Reinhardts Stärke ist die ideologiekritische Lektüre dieser Werke. Die über 100 zum Teil farbigen Abbildungen des Bandes sind daher mehr als nur Illustration. Die oft versteckten oder heute nicht mehr verständlichen Botschaften der Bilder dechiffriert Reinhardt historisch präzise und zeigt die machtpolitischen Interessen dieser Auftragsarbeiten. Die Propaganda und Geschichtsklitterungen der Päpste, des Adels und der städtischen Eliten, wie etwa der Medici, werden so offengelegt. Kunst diente als kulturelles Kapital, um die eigene (oft gar nicht so) noble Herkunft und das historische Auserwähltsein für alle sichtbar zu belegen oder auch einfach nur den vornehmen Geschmack und den eigenen gesellschaftlichen Status unter Beweis zu stellen.
Diese Indienststellung von Kunst und Architektur trifft der Titel „Die Macht der Schönheit“ also recht gut. Freilich ging dieses Kultursponsoring avant la lettre nicht immer nahtlos auf, denn der Künstler ist kein reiner Erfüllungsgehilfe. Bekanntestes Beispiel: In der Sixtinischen Kapelle malte Michelangelo sein eigenes, durchaus heterodoxes theologisches Programm und nicht jenes seiner Auftraggeber, der Päpste.
Reinhardts Kulturbegriff erscheint mitunter deckungsgleich mit einem klassischen Begriff der Hochkultur, denn im Mittelpunkt steht die Analyse hoch geschätzter Meisterwerke. Dieser steht somit quer zum heute gängigen, also viel breiteren, ja „totalen“ Kulturbegriff der Geisteswissenschaften, die sich mitunter ja auch Kulturwissenschaften nennen. Hoch- und Populärkultur werden hier nicht mehr getrennt.
Auch in die volkstümliche Kultur Italiens taucht Reinhardt freilich ein, die der Elitenkultur fremder gegenüberstand als im restlichen Europa. Was dachten die hungernden Aufständischen in Neapel im Juli 1647 wirklich? Michelangelo Cerquozzis Gemälde der Masaniello-Revolte etwa zeigt uns lediglich, wie die Oberschicht die Unterschichten wahrnehmen wollte: unvernünftig, gierig, einfachsten Bedürfnissen unterworfen und deshalb auch leicht verführbar und damit gefährlich. Dennoch: Gerade für das 20. Jahrhundert hätte man auch ganz andere kulturhistorische Zugänge wählen können, sei es über die Vespa, die Pizza oder die Gastarbeiter. Aufgrund Reinhardts eigener Expertise liegt der inhaltliche Schwerpunkt aber eindeutig auf Renaissance und Barock.
Das Buch ist ein im besten Sinne gelehrtes Kaleidoskop. Nicht nur Rom, Florenz und Venedig stehen auf dem Programm, auch die kulturellen Perlen der Provinz in Orvieto, Arezzo und Caserta werden gewürdigt. Es gehört zu Reinhardts Stärken, mit wenigen Sätzen auch komplexe historische Sachverhalte verständlich auf den Punkt zu bringen. Seine Leitfrage, was an einem Jahrtausend kultureller Kreativität spezifisch italienisch ist, findet aber eine traditionelle Antwort. Sie entsprang der inneritalienischen Konkurrenz zwischen den Städten und Herrschaften – mittendrin die Wahlmonarchie des Kirchenstaates als lange Zeit innovativste Kraft – wie auch der Bedrohung durch die zahlreichen Interventionen auswärtiger Mächte. Kurzum: Die „Italianità“ verdankt sich einer Abfolge politischer und sozialer Krisen.