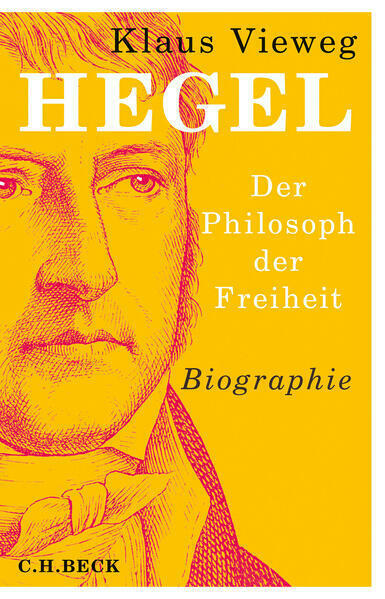Der Vater von Dialektik und Entfremdung
Alfred Pfabigan in FALTER 41/2019 vom 09.10.2019 (S. 45)
Biografie: Klaus Vieweg legt eine monumentale Biografie Georg Wilhem Friedrich Hegels (1770–1831) vor
Nahezu 900 Seiten umfasst Klaus Viewegs Hegel-Biografie – das bloße Volumen stellt den „Denkgiganten“ weit über die Aufbereitungen der Biografien eines Schopenhauer, Heidegger oder Nietzsche, die im letzten Jahrzehnt erschienen sind. Kommt dem Geehrten angesichts der massiven Kritik an seinem Denken diese herausragende Position überhaupt zu? Hat ihm nicht Schopenhauer als einzige Kunst jene attestiert, die Deutschen an der Nase herumgeführt zu haben? Hat nicht Marx von der „grotesken Felsenmelodie“ seiner Philosophie geschrieben und gefordert, die Dialektik „vom Kopf auf die Füße zu stellen“? Und sind da nicht die Anschuldigungen der Komplizenschaft seines Denkens mit den totalitären Regimen des vergangenen Jahrhunderts bei Popper?
Für den überzeugten Hegelianer Klaus Vieweg sind das Missverständnisse, die auf inkompetenter Lektüre beruhen. Bei Hegel geht es um das „Ganze“ der bürgerlichen Gesellschaft, gefasst in einem beeindruckenden System, das allen Konstellationen ihren Platz zuweist – und so will auch sein Denken als Ganzes bewertet werden. Wer sich ein Stück herauspickt, der verfehlt ihn. Die Begriffe des Meisters sind nur scheinbar der Alltagssprache entnommen, tatsächlich aber vielfach kontextualisiert, wobei die Kontexte dann wieder differenziert werden – und zwar so lange, bis sich alles in ein System fügt, als dessen grundlegende Orientierung Vieweg die bürgerliche Freiheit ansieht.
Doch sind es gerade einzelne Gedanken, die sich in unserer Kultur festgesetzt haben und denen der sperrige Autor seine Popularität verdankt, etwa die Begriffe Dialektik, Entfremdung und Anerkennung. Daraus ergibt sich ein Rezeptionsproblem, das Michel Foucault so beschrieben hat: Der listige Hegel sei uns nachgeschlichen, wir wüssten gar nicht, wie viel in unserem Denken von ihm stamme, und daher seien uns die Kosten eines Bruches mit ihm unbekannt.
Also: Jene außereuropäischen Philosophen, die etwa seine Abwertung der „geschichtslosen Völker“ als eurozentristisch erleben, haben einfach den Hegel’schen Begriff von „Geschichte“ mit seiner positiven Fixierung auf die Französische Revolution nicht begriffen, sind aber in ihrem Kampf um „Anerkennung“ hegelianisch inspiriert. Und jene, die sich – wie schon Hegels Schüler Heinrich Heine – am Doppelsatz stoßen, dass alles, was vernünftig sei, auch wirklich sei und alles Wirkliche vernünftig, und aus Hegel einen Apologeten der Restauration machen, haben eben nicht ganz verstanden, dass nicht alles, was da ist, auch wirklich ist.
Das Etikett „Biografie“ provoziert die Frage, wie einer gelebt hat, der den erfolgreichen Versuch unternommen hat, die Philosophie von vorne neu beginnen zu lassen, und ihr gleichzeitig durch eine allumfassende Systematisierung auf Basis des Erkenntnisstandes des frühen 19. Jahrhunderts die Weiterentwicklung zumindest erschwert hat. Vieweg spricht von einem ereignis-, spannungs- und kontrastreichen Leben, doch der Trailer täuscht: Der Autor bringt seinen Lesern das Denken Hegels nahe, seine Anteilnahme an der Person ist gering, und der Mensch Hegel bleibt verschwommen.
War der ehemalige Vorzugsschüler, dem der Klassenvorstand eine Shakespeare-Ausgabe schenkte, ein pedantischer Langweiler oder ein geselliger Charmeur? Die erhaltenen Quellen sind widersprüchlich. Dennoch: Auch wenn hier keine Psychobiografie eingefordert werden soll, wirkt die Beiläufigkeit, mit der Vieweg das „Ganze“ im Verhältnis von Person und Denken behandelt, befremdend.
Den Heranwachsenden haben die Ärzte zweimal aufgegeben, und mit 13 hat er die Mutter verloren: Hat das nicht mehr mit ihm gemacht, als sie zeitlebens in bester Erinnerung zu behalten? Eine merkwürdige Beziehung zur Haushälterin Christiane Burckhardt, die den gemeinsamen Sohn verstieß, eine Depression, die ihn – so Hegel 1810 – in Abgründe geraten ließ, in denen „jeder Beginn eines Pfades wieder abbricht und ins Unbestimmte ausläuft, sich verliert und uns selbst aus unserer Bestimmung und Richtung reißt“: Kann man die Sphären solcher Erfahrungen bruchlos vom Denken eines Menschen trennen? Und enthält dessen Feststellung, dass seine existierende Freiheit im Denken angesiedelt sei, weil er dabei „nicht in einem Anderen (sei), sondern schlechthin bey (sich) selbst bleibe“ und seine „Bewegung in Begriffen“ eine Bewegung in sich selbst sei, nicht ein interpretationsbedürftiges Element?
Viewegs Hegel ist eine reine Denkmaschine, und die Abgründe, von denen der Meister Hegel selbst sprach, werden verniedlicht. Der Philosoph habe „himmlischen Getränken kräftig zugesprochen“, Sorten und Händler werden genannt – aber hat einer, der bei einem Besuch in Nußdorf „einige Viertel vom goldnen Wein“ zu sich nimmt, nicht ein veritables Alkoholproblem – zumindest im Sinne der WHO? Vieweg bemüht sich, den Vorgaben des „Großmeisters der neuzeitlichen Philosophie“ zu folgen und rekonstruiert das Hegel’sche „Ganze“ mit einer akribischen Darstellung der Entwicklung von dessen Denken. Im Ergebnis lesen wir das Resultat einer beeindruckenden Rechercheleistung mit einer manchmal ein wenig ausufernden Rekonstruktion der Positionen auch zweitklassiger Protagonisten des deutschen Idealismus.
Viewegs Klagen über die Schwierigkeit der Lektüre Hegels sind nicht enden wollend. Aber auch sein eigenes Buch liest sich schwer – ein eigenartiger Zwitter, dessen Qualitäten ein Titel wie „Hegel in seiner Zeit – Rekonstruktion und Kommentar“ zwar besser beschrieben hätte, aber wohl aus Marketinggründen dem Etikett „Biografie“ weichen musste.