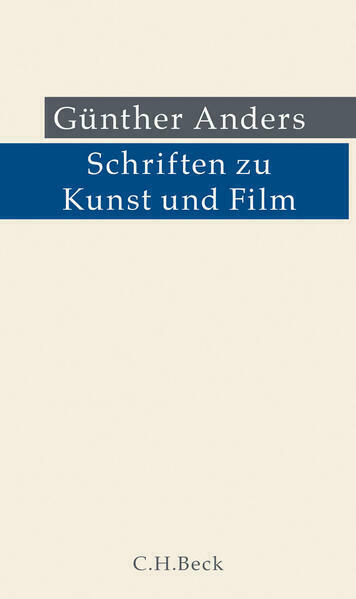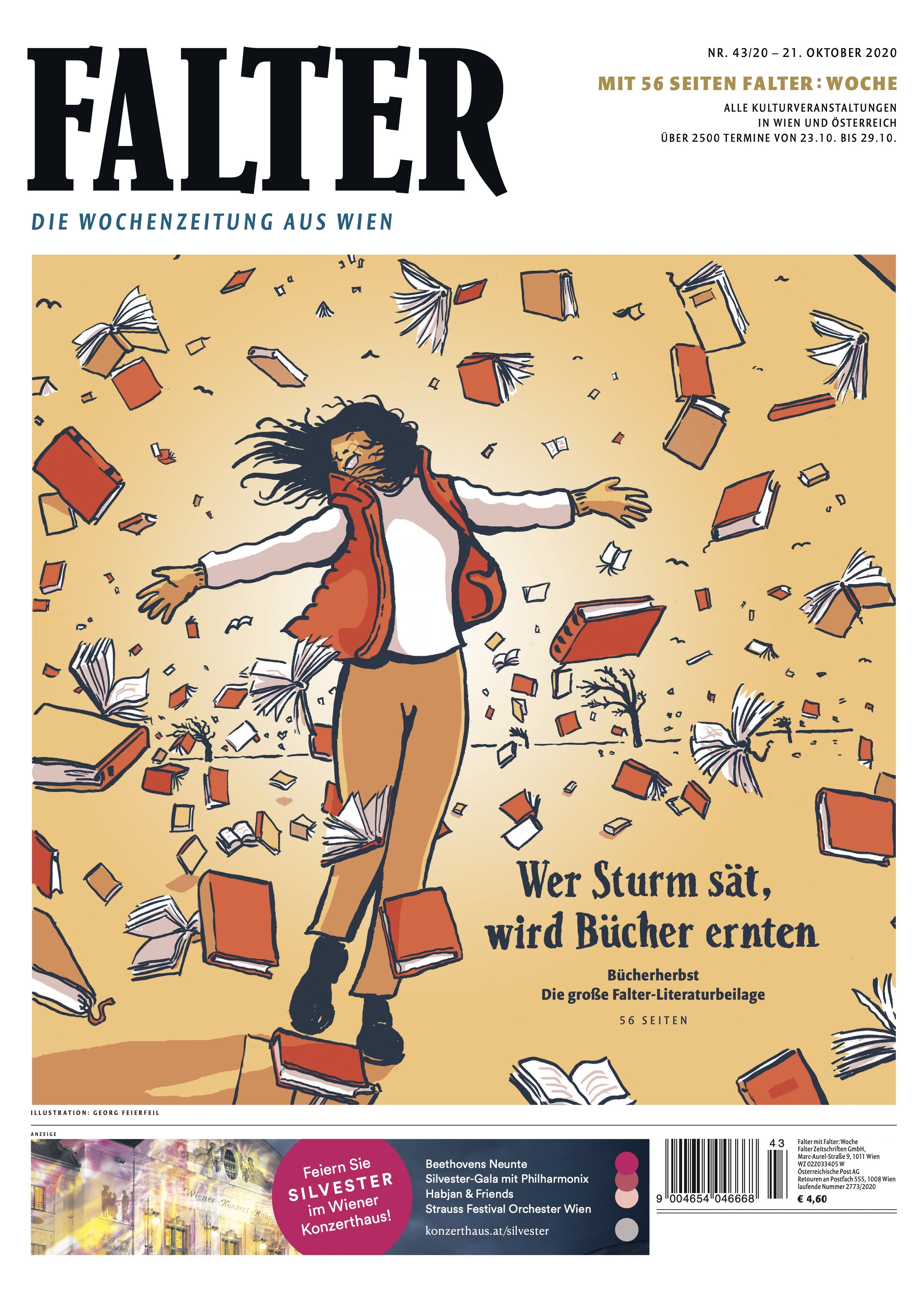
„Nennen Sie sich doch mal anders“
Michael Omasta in FALTER 43/2020 vom 21.10.2020 (S. 46)
Wenn man von Günther Anders sprechen hört, dann meistens im Zusammenhang mit seinem Hauptwerk, dessen Titel „Die Antiquiertheit des Menschen“ schon fast zu einem Bonmot geworden ist. Doch der Technik- und Medienphilosoph Anders – 1902 als Günther Stern in Breslau geboren, 1933 nach Paris und später Amerika emigriert, ab 1950 in Wien lebend und im Alter von 90 Jahren hier gestorben – verstand sich zeitlebens auch und vor allem als Schriftsteller. Er war bewandert in den Künsten, interessiert am Film, beschäftigte sich mit Musik und Ästhetik. Nach dem Studium der Philosophie (u.a. bei Ernst Cassirer, Edmund Husserl und Martin Heidegger) und Kunstgeschichte versuchte er sich als Privatgelehrter. Seinen Lebensunterhalt bestritt er jedoch mit Feuilletons. Herbert Ihering, der eminente Theater- und Filmkritiker des Berliner Börsen-Courier, soll seinen Redaktionskollegen dazu ermuntert haben, sich auch noch „anders“ zu nennen. So kam der junge Dr. Stern, seinerzeit mit Hannah Arendt verehelicht, zu seinem Künstlernamen.
Was man bisher für eine Anekdote halten mochte, wird durch Anders’ „Schriften zu Kunst und Film“ quasi beglaubigt. Schon diese Auswahl an Texten, deren Entstehung von Mitte der 1920er- („Absoluter Film“) bis Ende der 1980er-Jahre („Das Harmloseste“) reicht, zeigt ein literarisch vielfältiges Temperament, das sich in Tageszeitungen ebenso zu bewähren wusste wie in wissenschaftlichen Magazinen oder im deutschen Rundfunk, sowohl vor als auch nach dem Exil.
In einem dieser Radiobeiträge, datiert auf 1932, diskutiert Stern mit Ihering über „Das Dramatische im Film“. Rasch ist man sich über die Unterschiede zwischen Theater und Film, bei dem „Werk und Wiedergabe identisch“ sind, einig, um sodann die Eigengesetzlichkeiten des Films herauszuarbeiten. Eine „dramatische Szene“, sagt Ihering, könne im Film in ihrem Ablauf gar nicht wiedergegeben werden, rare Ausnahme: die Gerichtsszene. „Da sich im Ritus der Gerichtsverhandlung“, pflichtet Stern gerne bei, „das Leben schon selber stilisiert – man spricht ja auch vom Schauspiel eines Prozesses und von seinem Publikum –, (…) wäre jede weitere Stilisierung nur eine Verdoppelung.“ Vielmehr müsse der Film seine eigenen dramatischen Potenziale nutzen: die Spannung der Zeit, die Großaufnahme, die subjektive Kamera.
Letzteres greift Anders im kalifornischen Exil erneut auf. 1941 beginnt er in Hollywood in einem Kostümfundus zu arbeiten und bringt mehrere Filmideen zu Papier, unter anderem für einen experimentellen Kurzfilm, dessen Handlung zur Gänze aus der Ich-Perspektive des Helden gezeigt werden könnte. Ebenso nicht realisiert wurden „If“-Pictures, also Filme, die unter Einarbeitung dokumentarischen Materials alternative Geschichtsläufe aufzeigen sollten: Was wäre, wenn – der deutsche Generalstab sich beispielsweise 1939 geweigert hätte, einen Krieg zu beginnen? So absurd die Idee klingt, so topaktuell muss sie den Emigranten in der Filmmetropole erschienen sein. Ganz ähnliche Pläne wurden 1941 unter dem Arbeitstitel „If – The Other Way“ von Aladar Laszlo und Friedrich Torberg bei Warner Bros. gewälzt.
Faszinierend sind Anders’ Überlegungen zum Trickfilm, dessen Disney-Spielart er politisch geschärfte „Caricartoons“ entgegensetzte. Daran schließt, ein Jahrzehnt später, einer seiner vielen großartigen Beiträge zur bildenden Kunst an – hier über Francisco Goya und George Grosz. Grosz, mit dem er persönlich bekannt war, ist für ihn kein „Karikaturist im üblichen Sinne“ mehr: „Wessen Gesicht er zeichnete, der war ,gezeichnet‘. Wessen Typ er traf, der war getroffen wie von einer Waffe. Und wen sein Stift festhielt, der schien festgehalten, um abgeführt zu werden.“