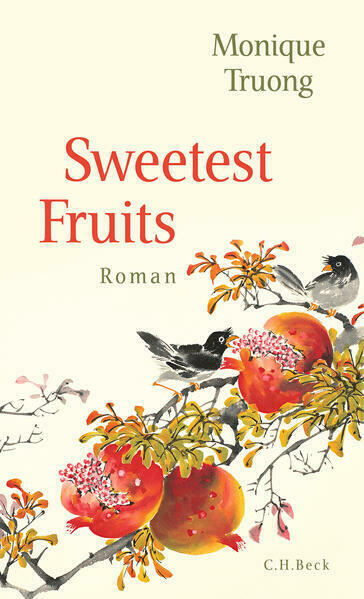Die Geister der anderen
Jutta Person in FALTER 11/2020 vom 11.03.2020 (S. 14)
Monique Truong erzählt die Geschichte des japanophilen Globetrotters Lafcadio Hearn aus der Sicht von vier Frauen
Im Sommer 1891, den Lafcadio Hearn und Setsu Koizumi an der japanischen Küste verbringen, möchte der irisch-griechische Schriftsteller das bon-odori beobachten, einen Tanz für die Seelen der Ahnen. Die Dorfbewohner, die noch nie zuvor einen Europäer gesehen haben, sind nicht einverstanden – um es vorsichtig zu formulieren. Hearns Gefährtin Koizumi dolmetscht kurzerhand, dass der Tanz in diesem Jahr wegen der Cholera ausfalle, eine glatte Lüge, die der Japan-Verehrer widerstandslos zu schlucken scheint. „Selbst als die Dörfler aus Hamamura händeweise Sand nach uns warfen, hast du mir noch geglaubt“, erinnert sich Koizumi in Monique Truongs grandiosem Roman, der nicht ganz so süß ist, wie der englisch gebliebene Titel vermuten ließe.
„Sweetest Fruits“ lässt vier Frauen zu Wort kommen, die möglicherweise mehr über Lafcadio Hearn zu sagen haben als er selbst. Und die, indem sie ihre eigenen Geschichten erzählen, auch das Leben des Essayisten, Sagensammlers und Englischlehrers Revue passieren lassen, der in den letzten Jahren weltweit wiederentdeckt wurde – als literarisch brillanter Schwärmer, aber auch als romantisierender Verklärer, dessen Faszination für alles Fremde, Farbige und Gemischte allmählich in japanisch-nationalistische Reinheitsfantasien übergeht.
Lafcadio Hearn wird 1850 als Sohn einer Griechin und eines irischen Militärarztes geboren, der mit seinem englischen Regiment auf der Insel Lefkada stationiert war. Mit 19 wandert er nach Amerika aus, arbeitet als Zeitungsreporter in Cincinnati und New Orleans und wechselt in die Karibik. 1890 landet er in Japan, heiratet die besagte Setsu Koizumi, eine Samurai-Tochter, mit der er vier Kinder zeugt, und arbeitet schließlich sogar als Universitätsprofessor. Die Moderne, die das alte Japan zerstört, wird sein größter Feind.
Die Stationen dieses vom Weggehen und Neuanfangen geprägten Lebens bilden aber nur das Gerüst für die vier Erzählerinnen, die vor allem eines klarmachen: Kein Mensch ist eine Insel, und hinter all den Lebens- und Geistergeschichten, die Hearn veröffentlicht hatte, zeichnet sich ein ganz anderes, weit verzweigtes Verbindungsnetz ab.
Wobei die erste Stimme, die Truong zu Gehör bringt, den Grundton vorgibt: Rosa Cassimati, Hearns griechische Mutter, berichtet klug, gewitzt und anrührend aus ihrem wohl ziemlich unglücklichen Leben; ihren Zweitgeborenen Lafcadio muss sie den irischen Verwandten ihres Mannes überlassen. Weil sie weder schreiben noch lesen kann, lässt sie eine jüngere Griechin alles aufzeichnen, in der Hoffnung, dass ihr Sohn sie eines Tages sucht und findet. Der aber wird zum ewig hungrigen, sehnsüchtigen und nie ganz verlässlichen Träumer – mit einer gewissen Routine im Vergessen und Verlassen.
Gegen den „Vorwurf der Unbeständigkeit“ versucht die zweite weibliche Stimme den meist in anderen Sphären schwebenden Hearn zu verteidigen. Die Journalistin Elizabeth Bisland hatte schon 1906 eine Hearn-Biografie verfasst – und liefert Truongs Roman damit die Quelle der gewissermaßen offiziellen Hearn-Wahrnehmung.
Mit den beiden Ehefrauen, die den Haupt- und Schlussteil von „Sweetest Fruits“ bestreiten, kann Bisland allerdings nicht konkurrieren. Das liegt auch daran, dass Truong diese Stimmen so stark und eindringlich werden lässt, dass man jeder einen eigenen Roman wünscht (am besten wieder übersetzt von Barbara Wenner, die für alle Figuren einen hervorragenden Klang gefunden hat): Die schwarze Köchin Alethea Fowley heiratet Lafcadio im Cincinnati der 1870er-Jahre, während er als Reporter arbeitet; als die Liebe abkühlt, lässt er die ehemalige Sklavin sitzen und zieht nach New Orleans weiter. Die zweite, japanische Ehefrau ist Setsu Koizumi. Sie durchschaut oder, besser: versteht, nach welchen komplizierten Sehnsuchtsmustern Hearn alles Japanische verfremdet und gleichzeitig in Besitz nimmt.
Vielleicht kann niemand besser von solchen Verwandlungen erzählen als die amerikanisch-vietnamesische Schriftstellerin Monique Truong. Ihr Roman „Das Buch vom Salz“ drehte sich um einen vietnamesischen Koch im Haushalt von Gertrude Stein und Alice B. Toklas – ein Paralleluniversum aus Fühl- und Schmeckbarem, in dem der große Identitätsimperativ außer Kraft gesetzt wurde. In ganz ähnlicher Weise bringt „Sweetest Fruits“ auf den Punkt, was kaum moderner sein könnte: die Urformel des Exotismus.