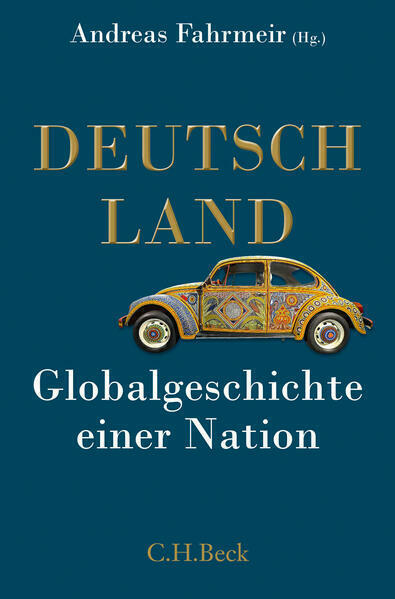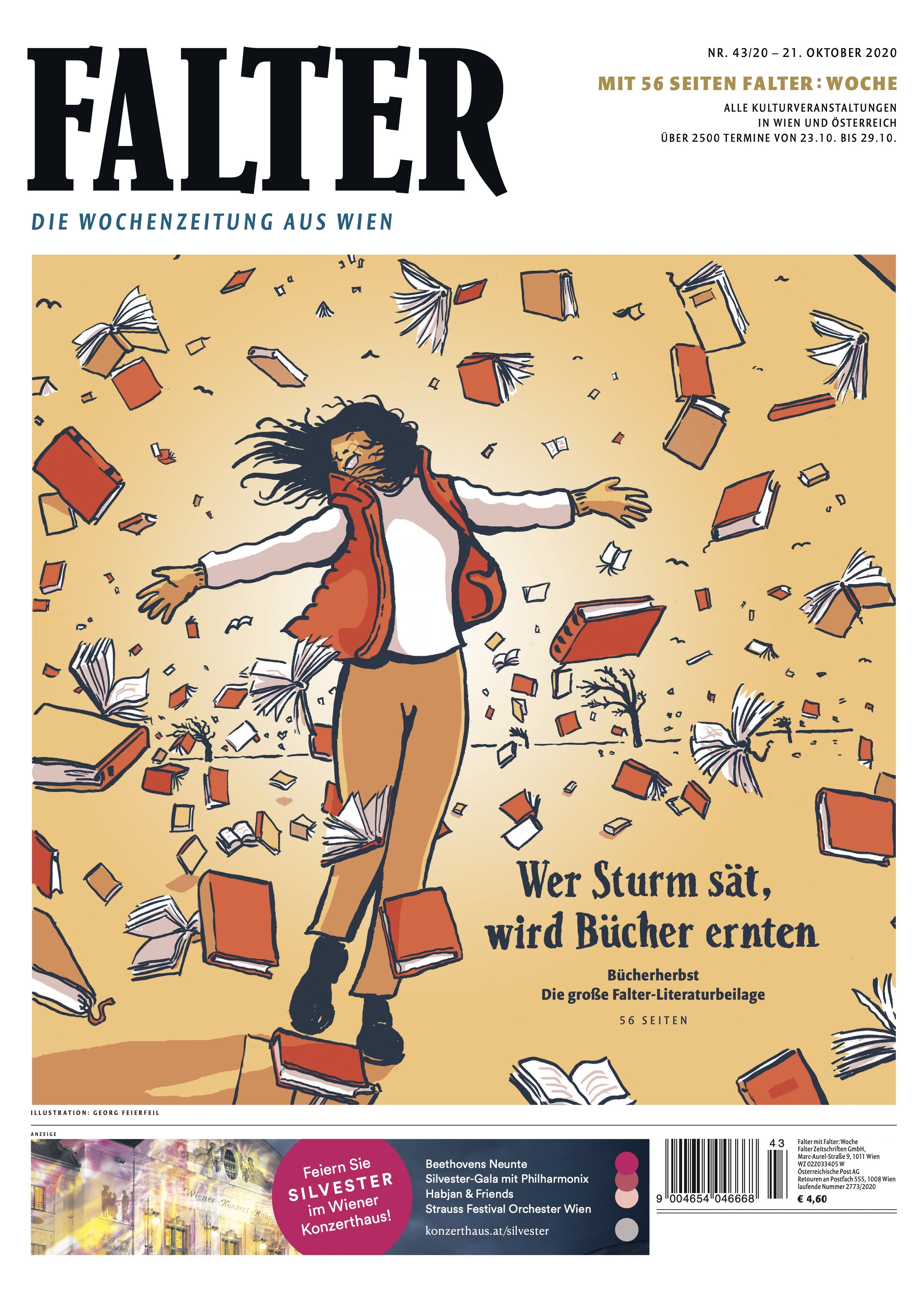
Germania Import-Export GesmbH
Oliver Hochadel in FALTER 43/2020 vom 21.10.2020 (S. 51)
Die moderne Geschichtswissenschaft entstand im 19. Jahrhundert, um den jungen Nationalstaaten ein historisches Fundament und damit auch politische Legitimation zu verleihen. Das ist lange her. Sich im 21. Jahrhundert auf reine Nationalgeschichte zu konzentrieren, wäre ungefähr so, wie wenn ein Chemielabor sich nur für ein Element interessieren würde, meinte der deutsche Historiker Sven Beckert einmal. Dieses Suchen nach transnationalen Zusammenhängen schlägt sich nun auch im populären Geschichtsbuch nieder. Das neue Genre einer „globalen Nationalgeschichte“ will anschaulich machen, wie sehr die Entwicklung der eigenen Nation immer schon aufs Engste mit dem Rest der Welt verflochten war. Die Franzosen waren 2016 die ersten, längst haben die Italiener und Spanier ebenfalls eine nationale Globalgeschichte publiziert – wie auch die Katalanen, Sizilianer und Flamen, wohl nicht ohne nationalistische Hintergedanken. Mit Verspätung legen nun auch die Deutschen nach mit „Deutschland. Globalgeschichte einer Nation“.
Das Strickmuster ist dasselbe: Das Buch ist ein Ziegel, die zahlreichen Artikel kurz, chronologisch geordnet, mit einer Jahreszahl als Haupttitel. Im deutschen Fall sind es 936 Seiten, 177 Kapitel, 172 Autoren, ganz überwiegend Historiker (und ganz überwiegend Deutsche), aber auch ein paar Journalisten und Schriftsteller. Das Kleinteilige soll zum Schmökern einladen, zum Hin- und Herspringen zwischen den Epochen. Das von Andreas Fahrmeir herausgegebene Buch beginnt 400.000 v. Chr. mit dem Homo heidelbergensis und den ersten Migrationsbewegungen in Mitteleuropa. Es endet aber nicht mit 2020 (vorletzter Artikel zur Pandemie), sondern humorvoll mit 20XX – dem Datum der Fertigstellung des Berliner Großflughafens.
Inhaltliche Qualität und Lesbarkeit der meisten Artikel sind gut bis sehr gut. Dennoch erweist sich das Genre als tückisch. Es überwiegen nämlich die „Exportartikel“, die darauf fokussieren, wie Deutsche und Deutsches den Weltenlauf beeinflussten. Neben Johannes Gutenberg (1454), Martin Luther (1517) sowie dem VW-Käfer (1964) finden wir etwa Künstler wie Albrecht Dürer, der als Maler in Venedig triumphiert (1506), oder die Kölner Networkerin Mary Bauermeister (1960) – und selbstredend jede Menge große Denker mit internationaler Ausstrahlung: die Frankfurter Schule (also Horkheimer, Adorno & Co in den USA), Martin Heidegger (in Frankreich) sowie Max Weber und Jürgen Habermas (überall).
Auch das deutsche Grundgesetz (1949) und das Verfassungsgericht in Karlsruhe wurden ab 1990 zu einem „Exportschlager“. Angepasst an die nationalen Verhältnisse inspirierte es Verfassungen in Osteuropa, aber auch in Südafrika nach dem Ende der Apartheid. Die Tennischampions Boris Becker und Co (1985) sowie die internationalen Literaturstars Daniel Kehlmann und Co (2005) werden ebenfalls gewürdigt. Ja, gelegentlich mutet der Band wie eine Leistungsschau „Made in Germany“ an.
Es gibt aber auch die Importartikel. Migration etwa ist ein Pflichtthema für jede nationale Globalgeschichte. Spannender als die Artikel zu den Auswanderern in den USA, Brasilien und Australien sind jene zu den sogenannten „Gastarbeitern“ seit den 1950er-Jahren. Die Bundesrepublik tat sich mit deren Integration schwer, insbesondere mit jenen aus der Türkei. Die Gefühlskälte der Richter im Prozess zu den NSU-Morden (2013) komplettiert das triste Bild. Kategorie Überraschung: Im Zweiten Weltkrieg kämpften tausende Inder aufseiten des Deutschen Reichs gegen die Alliierten (und gegen die französische Résistance). Für die Indian National Army war der Feind ihres Feindes (das Britische Empire) ein Verbündeter. Gern liest man auch Artikel Marke Mythenkratzer. Das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg war keineswegs eine rein nationale Leistung der ach so fleißigen Deutschen. Entscheidend war die international erwünschte Wiedereingliederung der jungen Bundesrepublik in die Weltwirtschaft – ganz anders als nach dem Ersten Weltkrieg.
Und dann gibt es jene eher raren „globalen Momente“, exemplarisch herausgearbeitet am Wiener Kongress 1814/15, dem Versailler Friedensvertrag 1919 und den Nürnberger NS-Kriegsverbrecherprozessen 1945/46. In diesen drei Fällen wurde mehr als nur das Schicksal von Deutschland oder Europa verhandelt. Die Zusammenkünfte wurden zu Kristallisationspunkten, die den Diskurs über internationale Beziehungen, nationale Selbstbestimmung und Menschenrechte entscheidend prägten.
Eine Globalgeschichte sollte versuchen, über ein rein buchhalterisches Import-Export-Schema hinauszukommen, um die intrinsische Verflochtenheit historischen Geschehens herauszuarbeiten. Sehr schön gelingt dies im Artikel über den „Kulturkampf“ (1871), in anderen Worten: Bismarck sekkiert die deutschen Katholiken. Diese Auseinandersetzung zwischen antiklerikalen, national-liberalen und kirchlich-konservativen Strömungen findet man auch im Frankreich der Dritten Republik und im Post-Risorgimento-Italien. Die Strömungen waren auch transnational verbunden. Statt vermeintlich nationaler Sonderfälle werden so die historischen Parallelen und Konvergenzen sichtbar. Eingestreut zwischen den Jahreskapiteln finden sich Texte, die sich dem Verhältnis Deutschlands zu benachbarten Regionen oder Ländern widmen, darunter auch Österreich, bekanntlich eine innige Beziehungsgeschichte. Fragt sich also nur noch: Wann kommt endlich die Globalgeschichte Österreichs? Wolfgang Amadé Mozart (1763) und Sigmund Freud (1938) wurden freilich schon im Deutschland-Band abgehandelt …