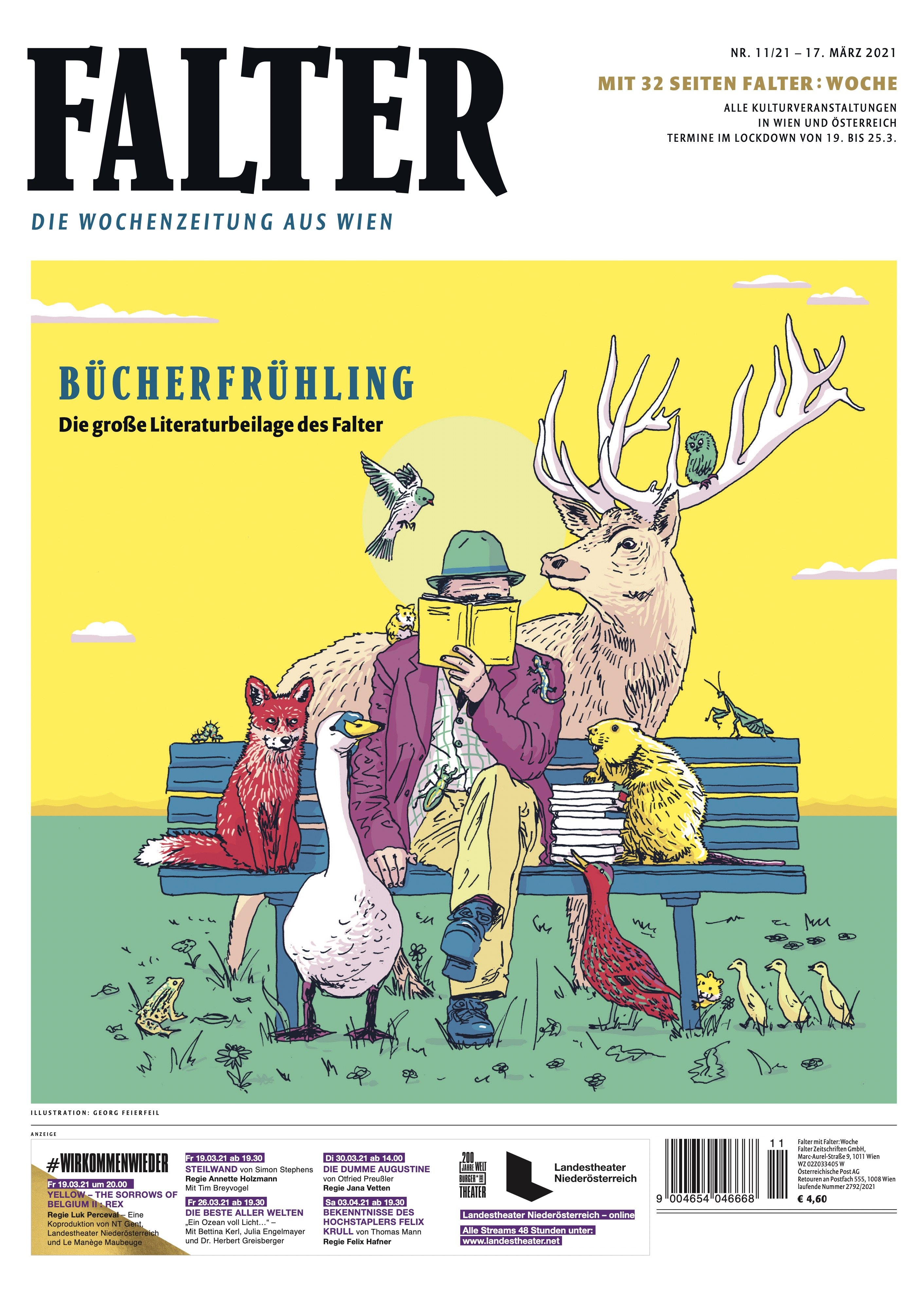
Einsame Wale, erfinderische Kraken, diskrete Hummer
Peter Iwaniewicz in FALTER 11/2021 vom 17.03.2021 (S. 45)
Die einzigen Tiere, denen ich auf gar keinen Fall begegnen wollte, waren Fische.“ Mit diesen Kindheitserinnerungen an das Meer beginnt Bill François seine „Unglaublichen Geschichten aus der Welt der Flüsse und Meere“, wie es der Untertitel seines Buchs „Die Eloquenz der Sardine“ verheißt. Eloquent ist dabei weniger die Sardine, sondern vor allem sein Erzählstil. Raffiniert verwebt er Elemente eines Entwicklungsromans mit marinbiologischen Fakten, Anekdoten und Historien, die bis in die Antike und wieder retour führen.
„Als das Meer gerade wieder einmal einatmete, sah ich hoch oben am Felsen am Rande der Wellen etwas aufblitzen. Ein Leuchten, das meinen Blick magisch anzog, vielleicht ein kleiner Schatz, ein Stück Perlmutt oder ein verlorener Gegenstand. Über die scharfen Felsen stolpernd kam ich dem schimmernden Etwas näher und näher. Und ich sah meine erste Sardine.“
Mit seinem anfangs immer sehr persönlichen Zugang saugt der Autor uns in seine Gedankenwelt hinein, um uns dann scheinbar ganz nebenbei etwas über die Haut der Sardine zu erzählen, die wie ein vollkommener Spiegel polarisiertes Licht aus jedem Winkel gleichmäßig reflektiert, sodass sie mit der Welt unter Wasser optisch verschmilzt. Da François dem Leser niemals das Gefühl gibt, sich doch in einem Lehrbuch zu befinden, folgt man ihm gerne auf seinen mäandrierenden Wanderungen durch das Leben unter Wasser. Dabei erfährt man, dass die Schuppen der Fische wie Bäume Jahresringe zeigen und dass die „Packungsdichte“ in einem Schwarm 15 Sardinen pro Kubikmeter ausmacht. Die Dichte an Menschen in einer U-Bahn zur Hauptverkehrszeit liegt bei einem Viertel des Volumens, dennoch stoßen wir, anders als Sardinen in voller Bewegung, dauernd aneinander.
Bevor all diese Informationen doch zu viel werden, sitzt man plötzlich wieder neben dem Schüler Bill François in einem Klassenzimmer und langweilt sich mit ihm im Mathematikunterricht. Seine Gedanken schweifen ab und wir mit ihm: Wie lernen Meerestiere? Trächtige Krakenmütter wagen sich nicht mehr aus ihrem Schutzraum, sterben an Nahrungsmangel, noch bevor der Nachwuchs schlüpft, und können diesem nichts beibringen. Ganz anders die Kindheit der Buckelwale, die mit ihrem Nachwuchs unentwegt kommunizieren und damit eine Form von Kultur entwickelt haben. Als die riesigen Heringsschwärme vor der Ostküste der USA vor einigen Jahrzehnten durch Überfischung verschwanden, mussten die Wale auf die schwieriger zu fangenden Sandaale Jagd machen und dazu eine neue Technik entwickeln. Diese wird auch an neu hinzukommende Tiere weitergegeben. Pädagogik und Didaktik sind also nicht nur unter Menschenaffen üblich, um erworbenes Wissen weiterzugeben.
Die einzelnen Kapitel funktionieren wie gut gemachte Youtube-Videos. Sie ziehen einen sofort in den Bann, füttern einen mit Fakten, und bevor man in die Abgründe der Tiefsee eintaucht, beginnt eine weitere Episode, von der man wissen will, wie sie weitergeht. François tischt uns ein opulentes Buffet mit großen und kleinen, neuen und bekannten Geschichten auf, ohne den roten Erzählfaden oder seinen literarischen, ja fast poetischen Stil zu verlieren. Sein Buch endet mit einem bewegenden Plädoyer: „Die Welt der Worte ist wie die Welt des Meeres: ein Raum der Freiheit. Und die muss sie auch bleiben. Wer die Worte zügeln will, dem Ausdruck und der Rede Regeln auferlegt, ist wie die Menschen, die im Meer Barrieren bauen. Also singen wir in Freiheit unsere Geschichten, jede und jeder auf seine Weise, ob wir nun der einsame Wal sind, der seine eigene Sprache spricht, oder eine Sardelle im aufeinander abgestimmten Schwarm, der erfindungsreiche Krake, der anhängliche Schiffshalter oder der diskrete Hummer. Halten Sie sich eine Muschel ans Ohr. Man hat mir erzählt, dass man darin das Meer hören kann.“ Ein wundervolles Lesebuch, das die Sehnsucht nach dem Meer und seinen Lebewesen lehrt.



