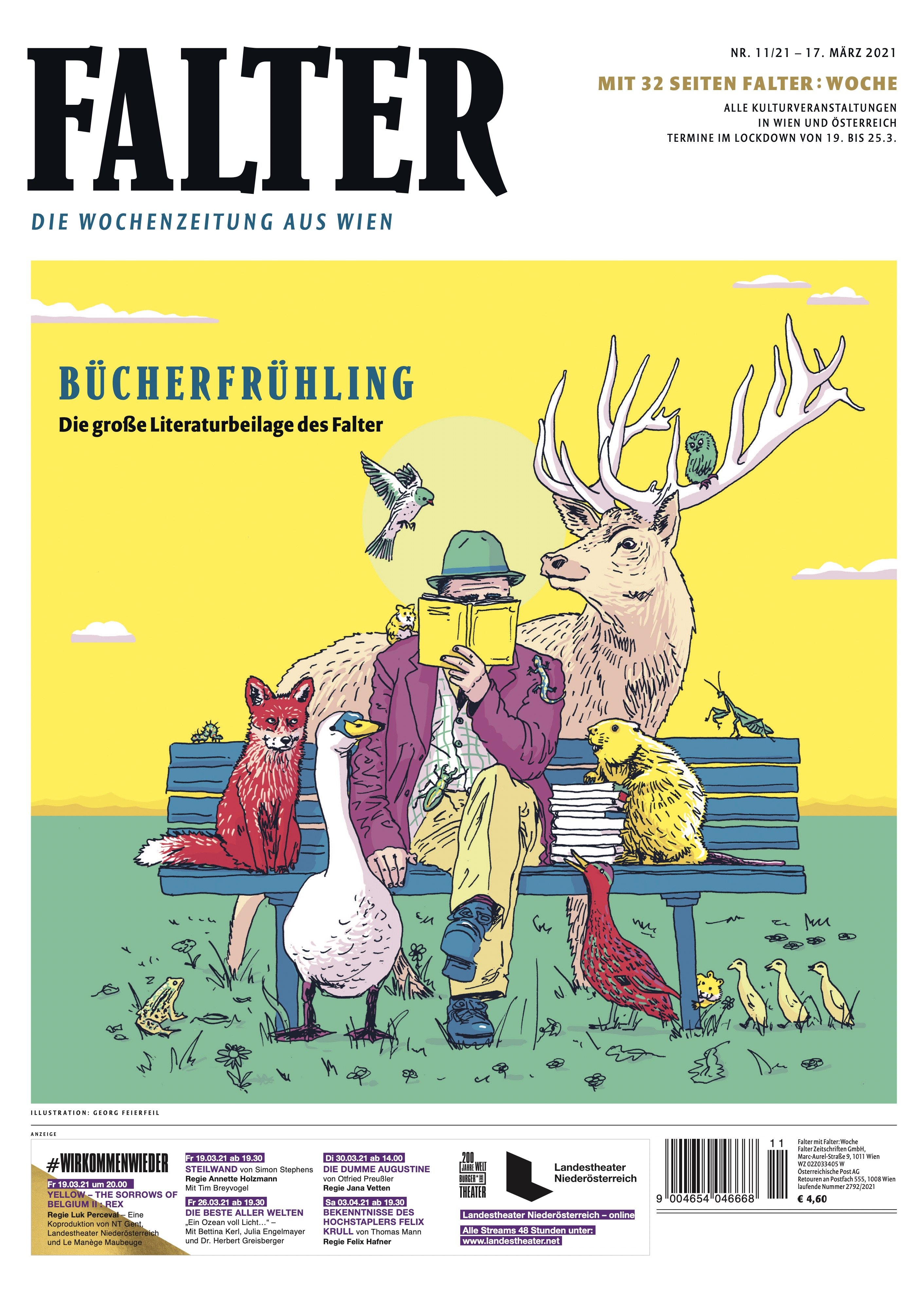
Die Seuche des Mittelalters
Thomas Leitner in FALTER 11/2021 vom 17.03.2021 (S. 38)
Als die Pest 1347 über Europa hereinbrach, raffte sie in den darauffolgenden Jahren ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung dahin und brachte das soziale und politische Gefüge auf mannigfaltige Weise durcheinander. Aus längerfristiger Perspektive allerdings änderte sich erstaunlich wenig: Die Pandemie hatte „keine völlig neuen Ideen oder Verhaltensweisen hervorgebracht, sondern mit ihren Erschütterungen lange vorher angelegte Überzeugungen, Grundhaltungen und Entwicklungstendenzen gefestigt und verstärkt“.
So lautet das Fazit in Volker Reinhardts „Die Macht der Seuche“. Der Untertitel, „Wie die Große Pest die Welt veränderte“, greift also ein wenig zu weit. Reinhardt, der zuletzt in „Die Macht der Schönheit“ (2020) eine facettenreiche Schilderung der Kulturgeschichte Italiens lieferte, erschließt sich „die Welt“ in konzentrischen Kreisen: In ihrem Innersten liegt Florenz, darum herum die Vielfalt der Stadtstaaten; bereits an der Peripherie der Betrachtungen Westeuropa und das Heilige Römische Reich, von den äußersten Rändern wird wenig berichtet. Gerade noch, dass Polen, weil von der Pest verschont, zu einer europäischen Macht aufsteigt, aber nichts von Russland und erstaunlicherweise kein Wort über Byzanz und das sich festigende Osmanische Reich, obwohl auch dort die Seuche wütete, ja aus dem Osten eingeschleppt worden war. Das ist aber auch der einzige Einwand gegen dieses spannende Buch.
So unterschiedlich sich die Pandemie in Mailand, Rom, Venedig und Florenz auswirkte, so verschieden die unmittelbaren politischen Strategien und ihre Konsequenzen zunächst ausfielen, setzten sich überall am Ende die alten Verhältnisse – arm und reich, oben und unten – wieder durch. Sprich: „Pestangst und Pestwut“ lösten zunächst Chaos aus, wurden dann aber instrumentalisiert und kanalisiert. In Rom gewann anfangs gegen das in internem Dauerzwist liegende Patriziat eine republikanische Strömung die Oberhand, begünstigt durch die finanzielle Schwächung, die die Abwesenheit der Päpste im Avignoner Exil mit sich gebracht hatte. Das „gute Volk“ sah sich zu Unrecht von der „Gottesstrafe“ mitbetroffen, war deren Grund in seinen Augen doch die Korruption der Herrschenden.
Und tatsächlich verlief die Seuche nach Einsetzung des Volkstribunen Cola di Rienzo relativ glimpflich, wohl aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte in der weitläufigen Stadt. Als der im Zeichen der moralischen Erneuerung gewählte Führer sich allzu sehr für seine Erfolge feiern ließ und Allüren eines Alleinherrschers zeigte, wurde er schon nach vier Jahren wieder gestürzt.
In Mailand übernahm das Haupt der herrschenden Familie Luchino Visconti die Rolle des starken Mannes. Ihm gelang das „Wunder von Mailand“: Ein sehr geringer Anteil der Bevölkerung fand in der ersten Welle der Seuche den Tod. Die Isolationsmaßnahmen waren allerdings beispiellos streng: Visconti wird gar nachgesagt, er hätte die Erkrankten einmauern lassen. Die Versorgung der Armen war hingegen gut organisiert. So stieg die Familie zur mächtigsten Dynastie Italiens auf und wurde gleichzeitig für ihre Feinde zum Inbegriff der verhassten Tyrannis.
In Venedig lief der administrative Apparat regelrecht heiß. Unzählige Dekrete wurden erlassen, die Wirksamkeit der hektischen Tätigkeit tendierte gegen null. Die einzig effiziente Maßnahme, die Abschottung gegenüber dem Festland und dem Fernhandel, traf man viel zu spät, da die Finanzinteressen der Oberschicht zu empfindlich getroffen worden wären. Selbst das Edikt zur Sperrung der Weinschenken trat nicht in Kraft, da die Händler Umsatzeinbußen nicht hinnehmen wollten.
Kaum eine Stadt wurde denn auch so hart von der Pest getroffen, und kaum eine Oberschicht diskreditierte sich trotz groß angekündigter „Gesundheitspolitik und Seuchenprävention“ so nachhaltig. Daran sollte auch der mysteriöse Putschversuch des greisen Dogen Marin Falier, der sich zum Anführer der städtischen Mittelschicht aufschwingen wollte, nichts ändern.
Nicht weniger heftig traf es Florenz. Zunächst funktionierte das politische Räderwerk der Institutionen, das Zusammen- und Gegenspiel der mächtigen Familien weiter wie gewöhnlich. Die Stadt fand sich aber in einem stärkeren Austausch mit dem ländlichen Umfeld. Das zeigt sich an den Klagen über Reiche, die sich in ihre toskanischen Villen zurückzogen, später in der Kritik an der „gente nuova“, den Neureichen: Verwandtschaft vom Land, die zur Elitenergänzung und „Blutauffrischung“ der Alteingesessenen in den Kreis der besseren Leute einbezogen wurde.
Es dauert noch Jahrzehnte, bis auch hier eine Mittelstandsbewegung die Hegemonie zu stürzen versuchte. Der Aufstand endete mit dem Griff einer der Familien nach derart uneingeschränkter Macht, wie man es nur von Mailand kannte. Cosimo de’ Medici machte aus seinem Namen Programm, verlieh damit dem angekratzten Renommee der Mediziner neuen Glanz und beflügelte die Verehrung seines Namenspatrons Kosmas, eines wundertätigen Heilers der Antike. Die Deutung der unter ihm erblühenden Renaissance als Feier des aus den Seuchenwellen erstandenen „uomo nuovo“ sieht Reinhardt allerdings als Konstrukt späterer Klassizisten an.
Den ausführlichsten Abstecher aus den italienischen Kunstzentren macht der Autor nach Avignon: Petrarca unternahm von dort aus (angeblich) die Besteigung des Mont Ventoux. Diesem Ausflug und den dabei angestellten Überlegungen über die menschlichen Geschicke angesichts der Pest ist das schönste Kapitel des Buches gewidmet. Der Vater des Humanismus und Günstling des hier residierenden Papstes Clemens VI., der schon in Reinhardts großer Papst-Enzyklopädie „Pontifex“ (2018) als eine der wenigen gewinnenden Persönlichkeiten hervorsticht, spielt auch hier, wenig überraschend, eine wichtige Rolle.
In der Praxis hatten sich seine Hygienemaßnahmen (etwa das Abbrennen von wohlriechenden Hölzern) als erfolgreich erwiesen. Zudem zeigte er theologischen Mut: Er sprach von Gottes unergründlichem Ratschluss statt von Strafe und lehnte Sündenbockprozesse ab, die sich zuvorderst gegen Juden richteten. Pogrome blieben im päpstlichen Umkreis sowie auch in Italien, außerhalb des Einflussbereichs des französischen Aristokraten, aus. Umso heftiger wüteten sie dagegen im Reichsgebiet.
Volker Reinhardt verbindet auf elegante Weise komplizierte und weitreichende Zusammenhänge. Er klopft zeitgenössische Stimmen auf Authentizität oder Stilisierung ab, öffnet Ausblicke auf literarische und bildnerische Glanzleistungen der Zeit und lässt manchmal auch die Gedanken in die Gegenwart abschweifen. Seine erzählerische Kunst macht aus schrecklichen Geschehnissen ein intelligentes Lesevergnügen.



