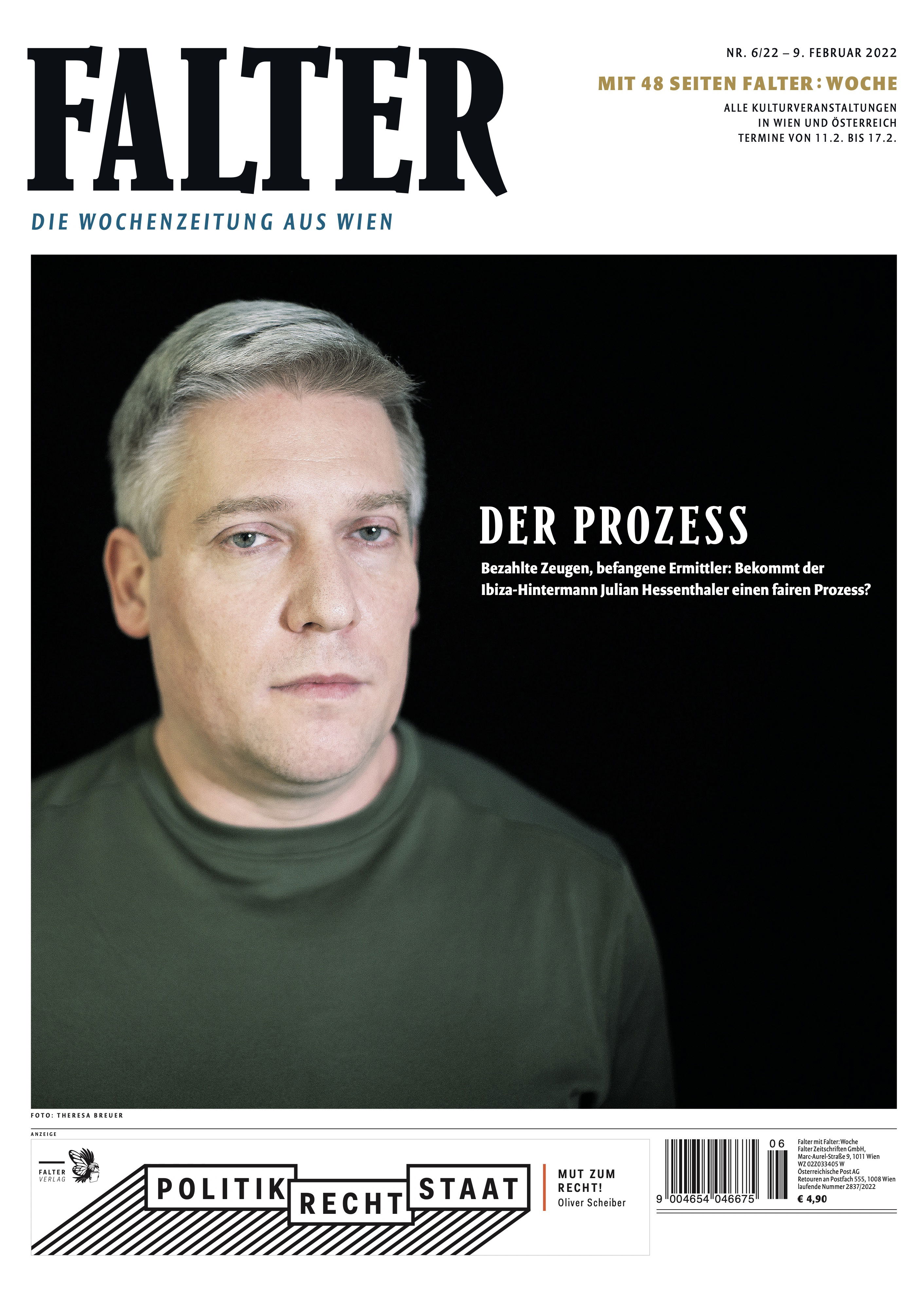
Warum wir unfähig sind, gemeinsame Ziele zu erreichen
Robert Misik in FALTER 6/2022 vom 09.02.2022 (S. 19)
Unsere Gesellschaft ist unglaublich leistungsstark und scheitert doch. Warum das so ist, seziert Armin Nassehi in seinem neuen Buch
Unsere Gesellschaft ist unglaublich stabil und leistungsstark und zugleich ganz offensichtlich unfähig, gemeinsame, gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Armin Nassehi, der Münchener Starsoziologe, argumentiert in seinem neuen Buch "Unbehagen", dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Nach zwei Jahren Covid-19-Pandemie scheint das das Buch zur Lage zu sein, denn dass wir in einer offenkundig "überforderten Gesellschaft" leben, das entspricht unserer Alltagswahrnehmung. "Überfordert" sind wir schon längst.
Doch für Nassehi ist diese Krise nur ein "Anschauungsbeispiel" für charakteristische Eigenheiten moderner Gesellschaften und für die krisenhafte Wahrnehmung von "Gesellschaft". Wir sind als Gesellschaft unfähig, entschieden auf Herausforderungen zu reagieren - aber das ist für Nassehi keine fatalistische Bilanz, sondern eigentlich logisch. Dass wir überrascht oder darüber sogar gekränkt sind, folge alleine daraus, dass wir eine falsche Vorstellung von "Gesellschaft" haben.
Wir verstehen uns als autonome Individuen. Als autonome Individuen sind wir vernunftbegabt. Es ist uns auch klar, dass wir nicht nur als individuelle Atome leben, sondern eingebettet in Sozialverbänden. Und außerdem leben wir in Nationen und politischen Einheiten. Alles zusammen nennen wir "Gesellschaft". Was wir eigentlich mit "Gesellschaft" meinen, darüber grübeln wir nicht so viel nach.
Genau das, so könnte man Nassehi zusammenfassen, ist unser Problem. Denn das führt zu Fehlurteilen. Etwa jenem, dass wir "als Gesellschaft" im demokratischen Prozess große Konzepte diskutieren, uns auf diese verständigen können und dass "die Gesellschaft" sich dann ändern könnte. Weltverbesserer sind überhaupt sehr fixiert auf die "Gesellschaftsveränderung". Bloß klappt die nie besonders gut.
Wir glauben aber oft, für jedes Problem gibt es nicht nur eine Lösung, sondern auch einen Zuständigen und einen Weg, diese Lösung in die Tat umzusetzen. Funktioniert aber nicht. Das führt zu dem Unbehagen, das Nassehis Buch den Titel gab. Denn wir haben Ansprüche an funktionstüchtige "Gesellschaften", an denen die real existierende Gesellschaft immer scheitert. Die Gesellschaft scheint uns dann als handlungsunfähig, da sie uns ihre "Selbstüberforderung" vor Augen führt.
Nassehi, ein aufgeweckter, durchaus progressiver Kopf, gilt heute als eine Art gemäßigter Vertreter der "Systemtheorie", die im Kosmos der deutschen Soziologie eher als konservativ gilt. Man muss das als relationales Verhältnis sehen: Während die Postmarxisten der Frankfurter Schule die Gesellschaft verändern wollten, hat die Systemtheorie "Gesellschaft" einfach nur analysiert und deren Selbstbewegung seziert. Gesellschaft prozessiert aus ihrer Sicht auf Autopilot. Wo Weltveränderer dauernd "wir müssen" oder "wir sollen" sagen, segelt die Systemtheorie hoch oben in der Vogelperspektive und sieht sich die Sache aus kühler Distanz an.
Nassehi präsentiert seine Diagnose überzeugend und mit bestechenden Argumenten und Exempeln. Veränderungen werden nur dann gelingen, wenn sie auf Gewohnheiten abzielen und alte allmählich durch neue Gewohnheiten ersetzen, legt er nahe. Politik sollte vielleicht überhaupt weniger über "Ziele" diskutieren, sondern über Prozesse und nächste Schritte. Zwischen einem deprimierten Fatalismus und dem gesellschaftsverändernden Aktivismus versucht er einen Mittelweg. Das wird einer Wirklichkeit, die stets ambivalent ist, durchaus gerecht, aber manchmal hat man auch das Empfinden, Nassehi will niemanden vor den Kopf stoßen.



