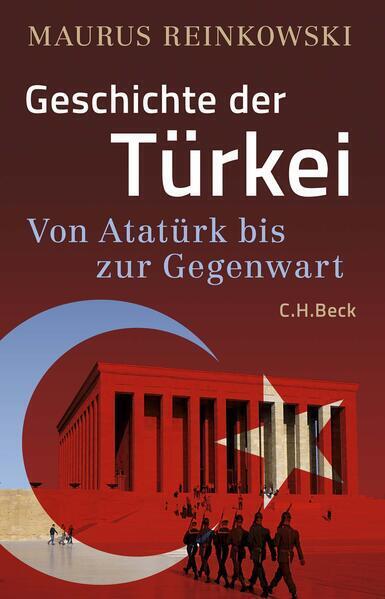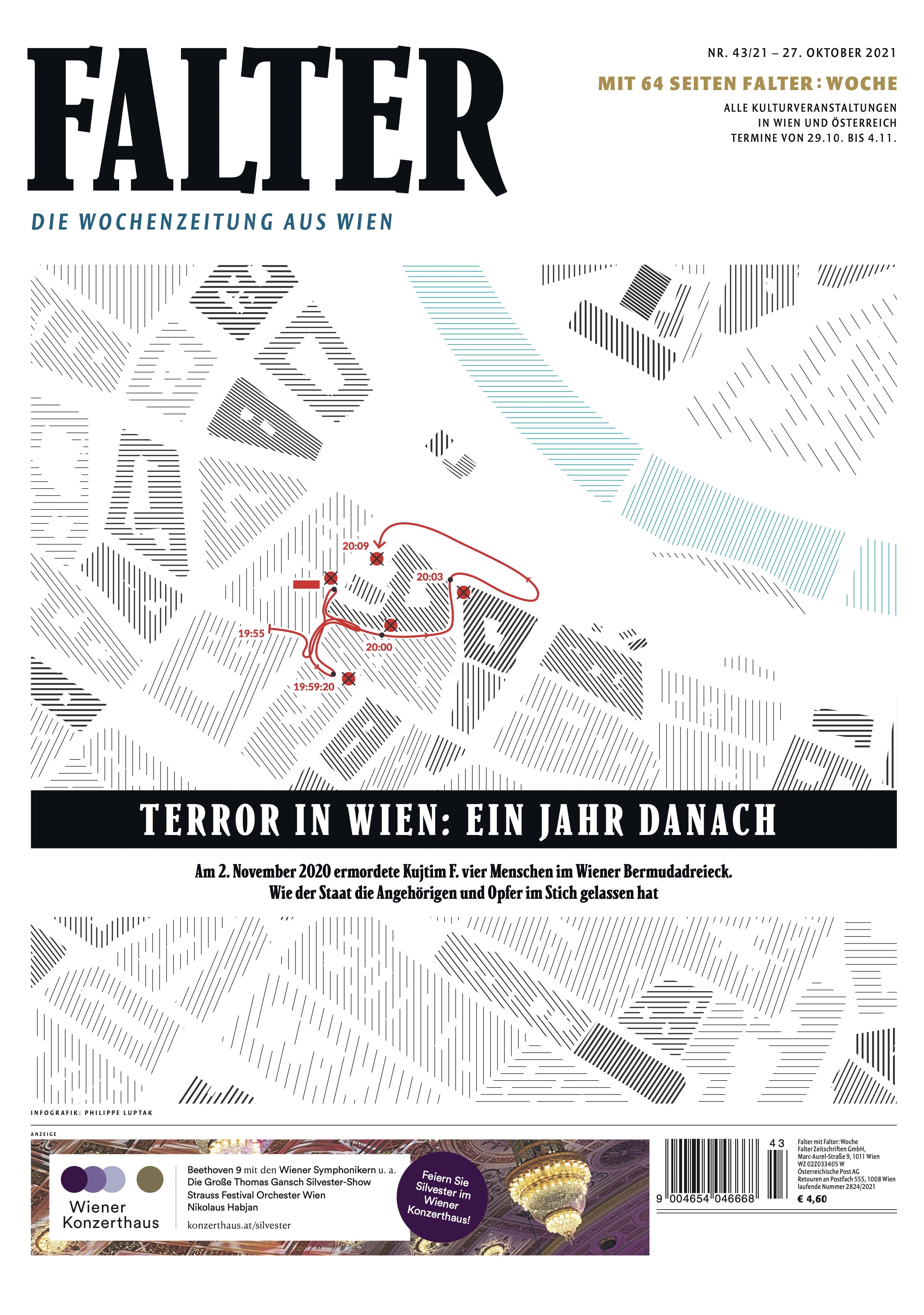
Ein Land zwischen Zuversicht und Zorn
Yavuz Köse in FALTER 43/2021 vom 27.10.2021 (S. 21)
Der Basler Islamwissenschaftler Maurus Reinkowski taucht tief in die Geschichte und den Gefühlshaushalt der Türkei ein
Die Türkei ist ein starkes, ein schwieriges, ein großartiges, ein zerrissenes Land. Maurus Reinkowski, Professor für Islamwissenschaft an der Universität Basel, hat ein höchst lesenswertes und zeitgemäßes Buch vorgelegt, das die Grundzüge der politischen Geschichte des Landes liefert, die wesentlichen Akteure und ihre politisch-ideologischen Positionen vorstellt und die komplexen soziopolitischen Entwicklungen sowie Spannungen elegant analysiert.
Der Autor umreißt in fünf Kapiteln die politische Geschichte der Türkei. Der Blick in die osmanische Vergangenheit ist dabei nicht nur Pflichtübung, sondern zentral, um, wie der Autor richtig feststellt, die in der gegenwärtigen Türkei diskutierten Fragen und Rückbezüge auf die Vorgeschichte der Republik Türkei besser nachvollziehen zu können.
Das zweite Kapitel widmet sich der kemalistischen Periode (1923–1950), gefolgt von einer näheren Betrachtung der Jahre 1950 bis 1980, die er als Phase des „prekären Pluralismus“ einstuft, nicht zuletzt, da drei Militärputsche (1960, 1971, 1980) das Land erschütterten.
Den „Verheißungen des islamischen Konservatismus“ und dessen Weg an die Macht (1980–2013) spürt das vierte Kapitel nach. Und schließlich führt uns der Autor im letzten Kapitel auf den „Weg in eine andere Republik“, die sich unter der Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) seit 2013 abgezeichnet hat.
Neben dem Gegensatz zwischen einem kemalistisch-säkularen und einem religiös-konservativen Lager, sieht der Autor den Gegensatz zwischen den etablierten urbanen Schichten und der ländlichen Bevölkerung, die ab den 1950er-Jahren zu hunderttausenden in die Großstädte strömte, als prägend für die jüngere Geschichte der Türkei.
Gewissermaßen als „Hintergrundrauschen“ könnte man seinen dritten leitenden Gedanken auffassen, nämlich das „Spannungsverhältnis zwischen Zuversicht und Zorn“, das der Autor als charakteristisch für den politischen Gefühlshaushalt der Republik bezeichnet.
Die Ursache für den ständigen Wechsel zwischen demokratischem Aufbruch und autoritärer Erstarrung, sei in den Vorstellungen der Türken über die eigene Vorgeschichte der Türkei zu suchen.
Auffällig jedenfalls sei das Nebeneinander und oftmals der „rasche Wechsel von Helden- und Opferrolle, von Virilität und Fragilität“.
Es fiele Türkinnen und Türken offensichtlich schwer, eine etwas gelassenere Einstellung ihrem Land und dessen Geschichte gegenüber einzunehmen; freilich einer Geschichte mit Abgründen, denen die politische Führung und Teile der Bevölkerung oftmals mit Abwehrreflexen begegnen.
Besonders lohnend sind Reinkowskis Ausführungen über die Jahre 2002 bis 2020. In den 2000er-Jahren führte die bis heute dominierende, aber nun bereits stark wankende AKP das Land zunächst in eine liberale und pluralistische Phase, die in den ersten Jahren getragen war von einer Aufbruchsstimmung, Reformbemühungen und einem wirtschaftlichen Aufschwung.
Spätestens nach den Gezi-Protesten von 2013 folgte ein abermaliger Rückfall in autoritäre Muster. Die islamistisch-konservative AKP-Regierung unter Recep Tayyip Erdoğan hat den „kemalistischen Komplex“ zerschlagen und die Türkei in eine präsidiale Republik geführt, die von einem Rechtsstaat etwa so weit entfernt ist wie die Aussicht der Türkei Mitglied der EU zu werden.
2023 wird die Republik Türkei ihr 100-jähriges Bestehen begehen; ungewiss bleibt, ob bis dahin das Pendel wieder in Richtung Demokratie schwingen wird und ob das Staatsoberhaupt Erdoğan, auf den in der Türkei alle Aufmerksamkeit gerichtet ist, dann noch im Amt sein wird.