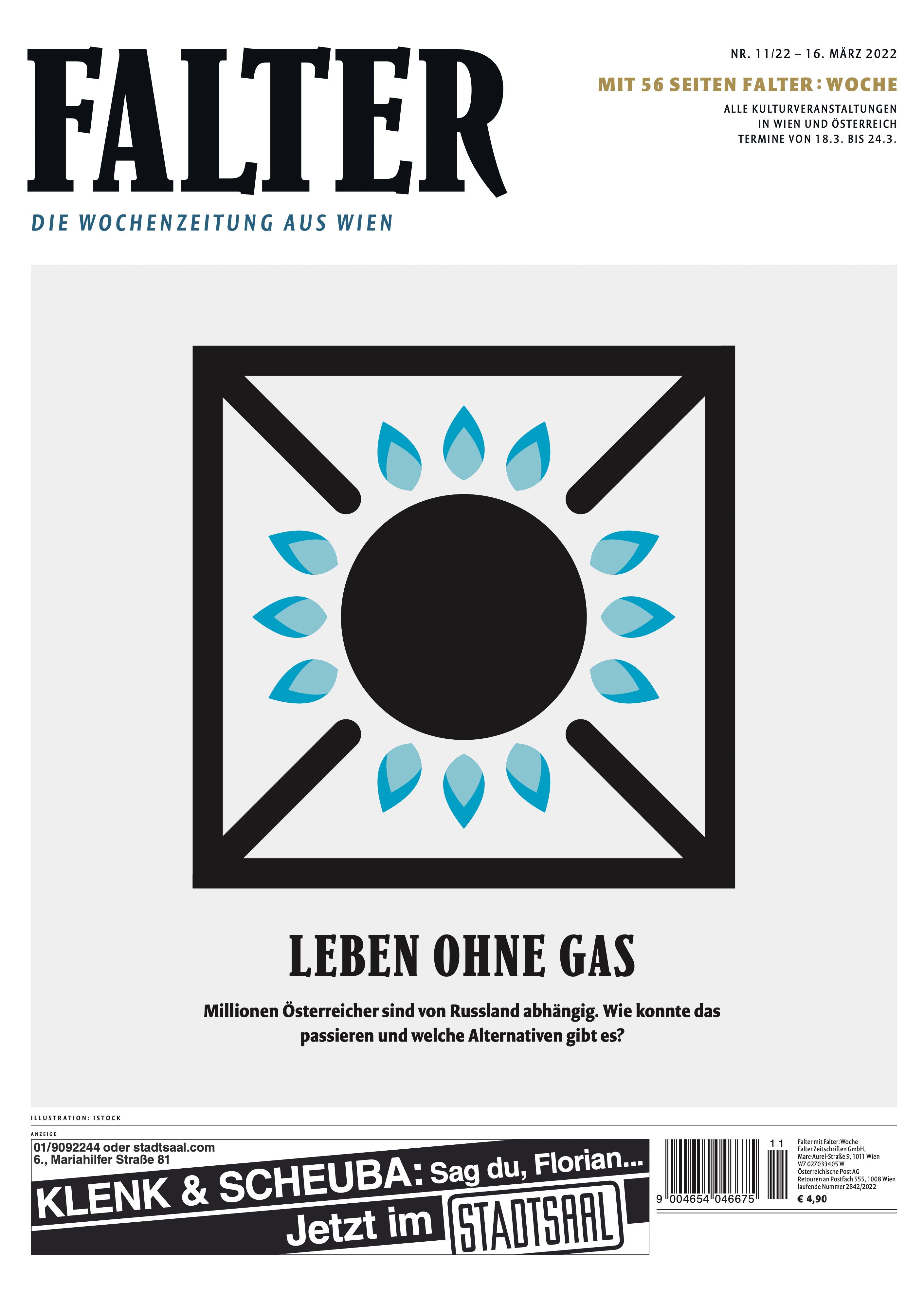
Willkommen bei den Printing Natives!
Andreas Kremla in FALTER 11/2022 vom 16.03.2022 (S. 36)
Was einmal draußen ist, lässt sich nicht zurückholen. Selbst wenn die höchste Autorität den Widerruf befiehlt und erfahrene Männer daran arbeiten: In der Praxis ist es kaum möglich, die einmal verbreitete Information einzufangen. Silicon Valley 2022? Mitnichten: Mainz 1520! Beatus Rhenanus, ein Lektor und Herausgeber der ersten Stunde, berichtet, wie eine Verbrennung von Büchern Martin Luthers kläglich scheitert: Die Volksmenge brüllt, dass Luther gar nicht rechtskräftig verurteilt sei. Der vom päpstlichen Gesandten Hieronymus Aleander mit der Hinrichtung der Druckwerke beauftragte Henker weigert sich, den Brand zu legen. „Zudem, so Rhenanus weiter, freuten sich die Pressen über Aleanders Treiben, denn für jedes verbrannte Exemplar würden zahlreiche neue gedruckt“, ergänzt Thomas Kaufmann. Mit Storys wie dieser macht der Professor für Kirchengeschichte lebendig, was hier aus seiner Sicht geschehen ist: die erste Medienrevolution.
Und er erklärt die Hardware im Hintergrund: Eine der vielen erstaunlichen Tatsachen, die der Autor zusammengetragen hat, ist das Ausmaß, in dem Handschriften im 15. Jahrhundert seriell produziert und in europaweiten Vertriebsstrukturen gehandelt wurden. Einer der zentralen Märkte war bereits damals die Frankfurter Buchmesse.
Die Geschwindigkeit der Informationsverbreitung blieb dennoch überschaubar – die Inhalte konnten die lokalen Autoritäten immer noch leicht kontrollieren. Auch aus dem wenig beachteten Zwischenschritt der „Blockbücher“ wurden keine Blockbuster. Die Holzblöcke, in die man ganze Buchseiten gravierte, um sie in der Presse zu drucken, ließen sich kaum mehr als einmal verwenden.
Schon damals war es die Zerlegung der Information in ihre kleinstmöglichen Einheiten, durch die Daten wesentlich schneller verarbeitet werden konnten. Was Gutenbergs Erfindung zu einem großen Wurf machte, war daher die Verwendung beweglicher Lettern. Im Unterschied zu Holzschnitt und Blockbuch konnten die aus Metall gegossenen Buchstaben beliebig oft neu kombiniert und verwendet werden. Eine essenzielle Voraussetzung lag im Werkzeugbau: Um die Typen der einzelnen Buchstaben in gleicher Größe produzieren zu können, hatte Gutenberg ein eigenes Gießinstrument entwickelt. Auch die rasch aushärtende Legierung aus Zinn, Blei, Antimon, Kupfer und Eisen, aus der die Typen gegossen wurden, war entscheidend, denn: Neue Informationstechnologien schaffen neue Wirklichkeiten.
Die auf Basis der eben erfundenen Hardware möglichen Applikationen und ihre sensationelle Wirkung beschreibt der Autor anhand des wohl ersten Medien-Stars: Martin Luther. Dass dessen 95 Thesen es auf ihre historische Reichweite brachten, war beileibe nicht dem damals gängigen Anschlag an der heimatlichen Kirchentür in Wittenberg zu verdanken. Luther hatte seine Polemik gegen den Ablasshandel genau zeitgleich in der weitaus bedeutenderen Drucker-Metropole Leipzig publizieren lassen. Doch auch dadurch wäre Luther wohl nicht zum bekanntesten Kirchenmann Europas geworden.
Seinen Durchbruch bescherte ihm das erste mediale Großereignis der Weltgeschichte: Zu Luthers Weigerung am Wormser Reichstag, seine Aussagen gegen Ablasshandel und Papsttum zu widerrufen, erschienen über 100 gedruckte Kommentare. „Niemals seit Gutenbergs Erfindung war über ein Ereignis zeitnäher und dichter geschrieben, berichtet, publiziert worden“, ordnet der Autor dies ein.
Thomas Kaufmann weiß, wovon er spricht. Der evangelische Theologe arbeitet vor allem als Kirchenhistoriker, unterrichtet dieses Fach an der Universität Göttingen und ist Mitglied der dortigen Akademie der Wissenschaften, zudem Abt des Klosters Bursfelde. Über den Ketzer-Pionier hat er bereits ein eigenes Buch verfasst („Martin Luther“), ein weiteres über die Folgen von dessen Werk („Erlöste und Verdammte“). Seine Beiträge zur Geschichte der Reformation, unter anderem als wissenschaftlicher Berater für Fernsehdokumentationen, wurden mehrfach ausgezeichnet.
Auch wenn er Luther als das Epizentrum einer sich verändernden Welt darstellt, bleibt Kaufman nicht an ihm kleben. Viele andere „Printing Natives“ bekommen ihren Auftritt, die mit dem neuen Buchdruck gesellschaftlichen Veränderungsdruck erzeugen, sei es als Autor oder als Handwerker. Albrecht Dürer etwa wird als Pionier des Markenzeichens gewürdigt, samt einem Abdruck seines Signets. Am Beispiel des Erasmus von Rotterdam zeigt Kaufmann, wie ein großer Geist erst durch die neuen Druckereien seine Wirkung entfalten kann. Und auch die ersten viral verbreiteten Fake News lernt man kennen: die Judenschriften des Johannes Pfefferkorn. Am Ende stellt er all das technisch Mögliche und nunmehr weithin Teilbare in den Zusammenhang eines breiter werdenden gesellschaftlichen Diskurses, der sich zunehmend der Kontrolle durch die Obrigkeit entzieht.
Kaufmann zoomt äußerst präzise in einen Ausschnitt unserer Geschichte, in dem sich Wahrnehmung und Gestaltungsmöglichkeiten unserer Welt massiv änderten. Gestochen scharfe Beschreibungen dieser Zeit, ihrer noch ganz anders tickenden Bewohnerschaft und der in vielen Zitaten wiedergegebenen Sprache sind es, die das Buch lebendig zu lesen machen. Nur an manchen Stellen bremsen die Details aus offenbar höchst umfassender Recherche den Lesefluss. Dem Drang, weiter mitzuerleben, wie der Druck aus der Druckerpresse eine hellere, offener werdende Welt vorantreibt, tut das keinen Abbruch. Wie mit einer Zeitmaschine nimmt Kaufmann seine Leserinnen und Leser mit in ein Vorvorgestern, das noch ganz anders funktioniert als unser Heute. Und doch zeigt er Parallelen zwischen jetzt und damals auf: wie sich eine Gesellschaft anfühlt, in der technische Innovation neue Möglichkeiten schafft, Gedanken schnell und über große Distanzen zu teilen.



