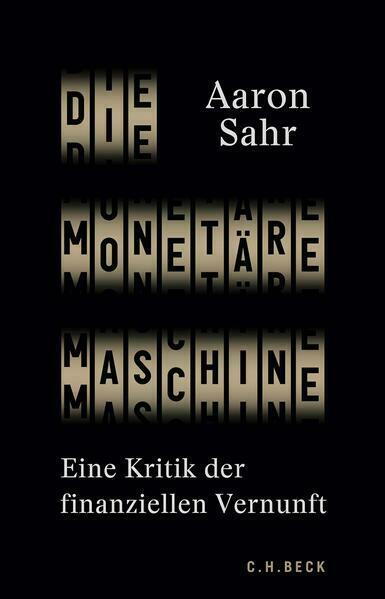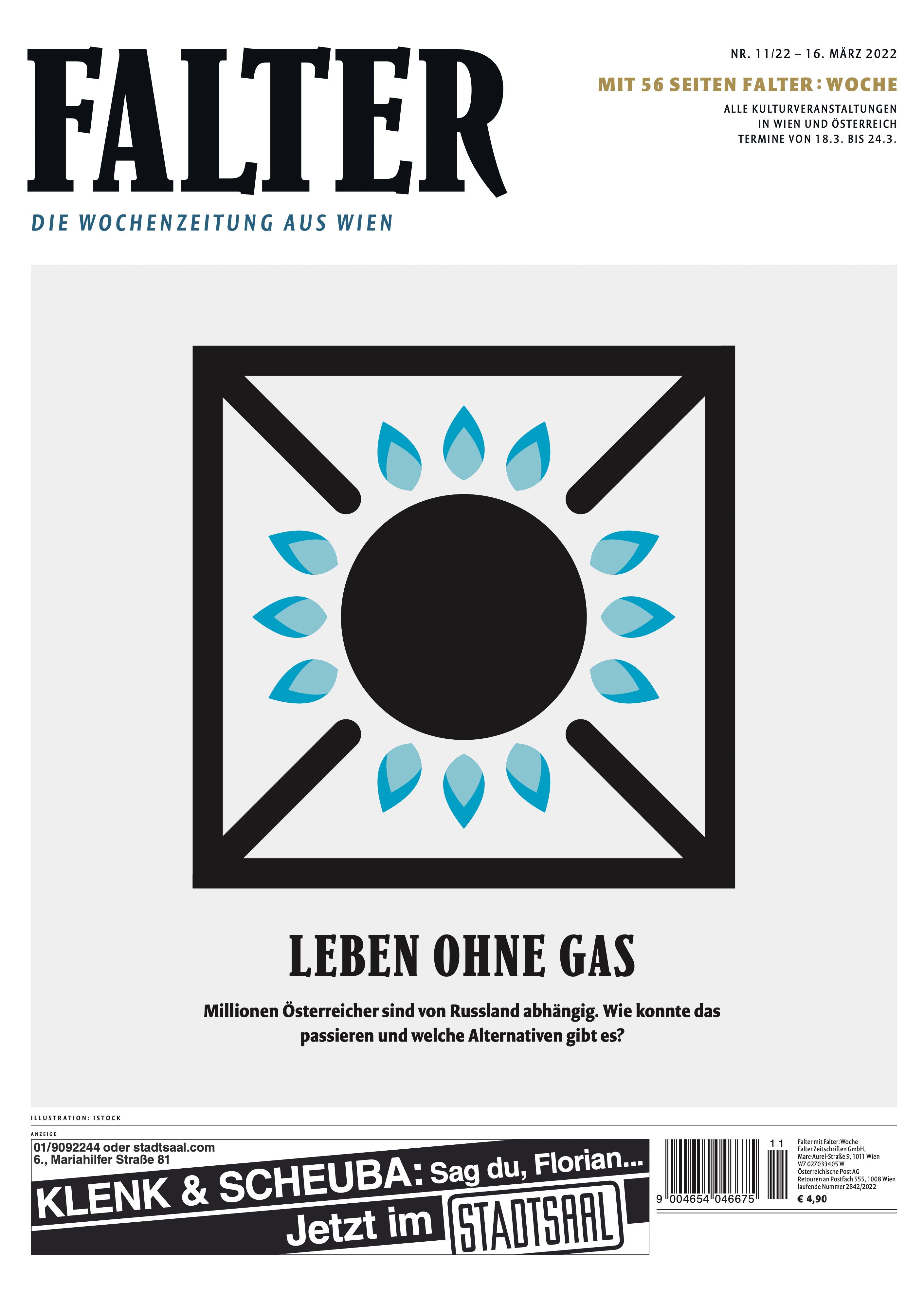
Was die Welt regiert? Eine Geldmaschine!
Andreas Kremla in FALTER 11/2022 vom 16.03.2022 (S. 40)
Unser Finanzsystem lässt sich als eine Sammlung verschiedenster Tauschwerkzeuge für Geld und Waren beschreiben. Oder, wenn man Aaron Sahr folgt: Es ließ sich so betrachten. Denn genau das sei nicht mehr möglich, meint der Wirtschaftssoziologe. Heute müsse man das Finanzsystem als Struktur verstehen, in der alle Bauteile, Geldbeträge und Bilanzen wie in einem komplexen Apparat zusammenwirken. Kurz gesagt: Geld ist eine Maschine.
Ausgangspunkt von Sahrs Überlegungen ist die „Modern Monetary Theory“, eine von den Nachfolgern John Maynard Keynes’ geprägte Geldtheorie. Sie sieht wesentliche Hebel für den Wert des Geldes nicht in den Mechanismen freier Märkte, sondern in der Verantwortung von Regierungen: In deren Macht liege es, mehr oder weniger Geld zu produzieren.
Diese Geldschöpfung hält Sahr für eine der zentralen Machtressourcen der Maschinerie. Gerade diese friste aber ein „Schattendasein“ in den stillen Kammern mächtiger Zentralbanken; abseits des Zugriffs durch gewählte Volksvertreter. Dass sich die Geldschöpfungs-Politik somit der demokratischen Steuerung entzieht, sieht Sahr als Sieg einer Ideologie, die das Geld entpolitisieren will. Das legt die Latte für sein Werk hoch: „Ziel dieses Buches ist (…) die Überwindung eines herrschenden Denkens, das unser Verständnis der monetären Welt verzerrt und damit unsere Wahrnehmung finanzieller Möglichkeiten und Abhängigkeiten verschleiert – eine Kritik der finanziellen Vernunft.“
Dazu liefert Sahr eindrucksvolle Zahlen: Obwohl das Wirtschaftswachstum zumindest in den OECD-Staaten seit Jahrzehnten moderat verläuft, ist das verfügbare Geldvolumen um ein Vielfaches gestiegen: Hundert Mal so viel Geld wie 1980 sei heute im Umlauf – während sich die Wirtschaftsleistung nur aufs etwa Zweieinhalbfache gesteigert habe.
Erfreuen sich nun alle größeren Wohlstands? Weit gefehlt! Gewonnen haben durch die wundersame Geldvermehrung laut Sahr einmal mehr jene, die Geld haben und es investieren können. Für Lohn- und Gehaltsempfänger ändere das wenig; für Menschen ohne Arbeit gar nichts. Im Gegenteil: Sozialleistungen für Ärmere würden unter dem Geldsegen der Reichen leiden – so wie die gesamte öffentliche Infrastruktur von Abfallwirtschaft über Klima-Investitionen bis zu Verkehrsausgaben. „Weltweit“, so Sahr, „fehlen 15 Billionen US-Dollar für notwendige Infrastrukturausgaben (bis 2040).“
Die Vorleistungen, die die Geld-Maschine für die Gesellschaft erbringt, seien ebenso als kritische Infrastruktur zu betrachten und entsprechend zu steuern – nicht auf kapitalistische Einzelinteressen, sondern aufs Gemeinwohl hin.
Sahr leitet die Forschungsgruppe „Monetäre Souveränität“ am Hamburger Institut für Sozialforschung. Schon in seinem Debüt „Das Versprechen des Geldes“ (Hamburger Edition, 2017) hat er eine soziologische Sicht des Geldes entwickelt. Die Welt-Geld-Maschine in all ihrer Komplexität darzustellen gelingt; ebenso überzeugt die daraus abgeleitete Forderung einer politischen Steuerung. Bloß auf Komplexitätsreduktion darf man hier nicht hoffen. Auch wenn der Autor sein Versprechen hält, dass das Werk ohne Vorkenntnisse in Mathematik oder Rechnungslegung lesbar sei, erfordert es doch gehörig Konzentration und starkes Interesse an wirtschaftspolitischen Zusammenhängen.
An der Grenze von Sachbuch und Fachbuch liefert Sahr eine scharfsinnige Analyse unseres weit über banale Tauschmittel hinausgewachsenen Geldapparats – und der Notwendigkeit, diesen im Sinne des Gemeinwohls zu steuern. Allerdings erschließt sich sein Buch wohl einer ähnlich kleinen Zielgruppe wie seinerzeit Kants „Kritik der reinen Vernunft“. Zu wünschen bleibt, dass es ähnlich großen Einfluss auf unseren gesellschaftlichen Diskurs entfaltet.