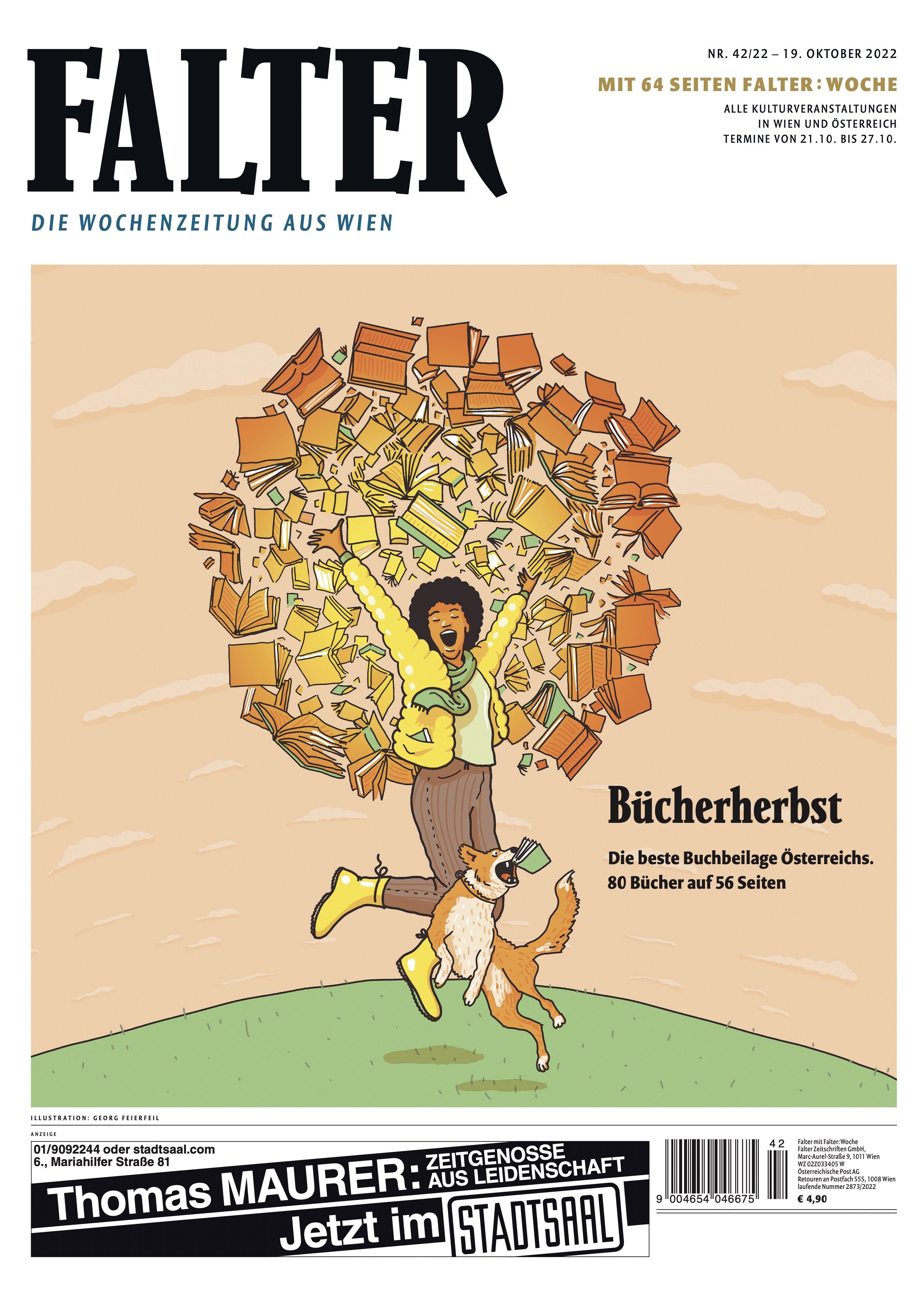
Gezeichnete Leben
Julia Kospach in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 51)
Man vergisst es inzwischen leicht, doch es ist noch nicht lange her, dass sich Comics außerhalb von eingeschworenen Fankreisen etabliert haben. Und zwar als Medium, das zu Recht Anspruch darauf erhebt, auch abseits von Mickey Mouse und Superheldentum Geschichten und Geschichte erzählen zu können. Mittlerweile ist die Auswahl an gezeichneten Politreportagen, Biografien und Romangeschichten gewaltig. Unter dem Aufwertungsetikett Graphic Novel erlebt das Genre einen echten Höhenflug.
Als großer Durchbruch für die internationale Anerkennung von Comics gilt nach wie vor Art Spiegelmans bahnbrechender, zweiteiliger Schwarz-Weiß-Comic „Maus“ aus den Jahren um 1990, in dem der US-Zeichner die Erinnerungen seines Vaters an den Holocaust schilderte. „Maus“ war der erste Comic, der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Das war von unschätzbarem Wert für das gesamte Medium.
Seither hat es international und auch im deutschsprachigen Raum zahlreiche weitere zeichnerische Annäherungen an den Zweiten Weltkrieg, an Nationalsozialismus und Holocaust gegeben, die eindrücklich und auf sehr verschiedenartige Weise vor Augen führen, dass zeichnerische Geschichtsvermittlung einen besonderen Mehrwert darstellt – künstlerisch und erzählerisch ebenso wie in der Möglichkeit, ein anderes und neues Publikum für historische Inhalte zu interessieren.
Aus genau diesem Wunsch entstand auch die Idee zur Graphic Novel „Aber ich lebe“: Sie versammelt drei Comics in einem Band, die nach den Erinnerungen von vier Zeitzeugen entstanden sind, die alle als Kinder im Volksschulalter den Holocaust überlebt haben. Die Idee dazu stammt von der kanadischen Germanistin und Holocaust-Forscherin Charlotte Schallié, der es – als Mutter eines lesefaulen, aber Graphic-Novel-affinen 13-Jährigen – darum zu tun war, neue visuelle Ansätze für das Sammeln, Bewahren und Verbreiten von Zeitzeugenberichten zu fördern. Was sperrig klingt, hat durch die besonders enge Zusammenarbeit aller Beteiligten an diesem kanadisch-israelisch-deutschen Gemeinschaftsprojekt eine ganz spezielle und speziell gelungene Graphic Novel werden lassen.
Die Überlebensgeschichten von Emmie Arbel, David Schaffer und dem Brüderpaar Nico und Rolf Kamp könnten nicht unterschiedlicher sein.
Die in Holland geborene Emmie Arbel, die der Münchner Comic-Zeichnerin Barbara Yelin ihre Geschichte erzählt hat, überlebte als kleines Mädchen zwei Konzentrationslager und lebt seit langem in Israel. Faszinierend ist nicht nur, wie Barbara Yelin Emmie Arbels gleichermaßen bruchstückhafte („Ich erinnere mich nicht“) wie drastische Erinnerungsbilder an ihre KZ-Zeit, an Hunger und Gewalt oder an den miterlebten Tod ihrer Mutter in dunkel gehaltene Bildfolgen umsetzt, sondern auch, wie gelungen sie in ihren Bildern zwischen Emmie Arbels Vergangenheit und ihrem heutigen israelischen Alltag hin und her wechselt. So sehr Erzählgegenwart und erinnerte Vergangenheit auch kontrastieren, so sehr visualisieren die bei Yelin vorherrschenden, oft verwaschenen und ineinander übergehenden Blau- und Grautöne die durchgehende Prägung durch das Erlebte bis ins Heute hinein.
Völlig anders ist der an naive, kindliche Wasserfarbenmalerei angelehnte Zeichenstil, den die israelische Comiczeichnerin Miriam Libicki für David Schaffers Odyssee gefunden hat: Libickis Figuren haben riesige, fragende Augen, in denen das ganze unerklärliche Entsetzen enthalten scheint, das David Schaffer als Kind erlebt hat. Gemeinsam mit seiner Familie wurde er aus der Bukowina vertrieben und wanderte völlig mittellos mehrere Jahre, vor allem in den Wäldern Transnistriens, unter größten Gefahren und Entbehrungen zwischen den Fronten umher.
Nicht weniger dramatisch, wenn auch völlig anders beschaffen ist die Geschichte des jüdisch-holländischen Brüderpaares Nico und Rolf Kamp, die der israelische Zeichner Gilad Seliktar auf stark stilisierte, reduzierte Weise unter Verwendung von nur vier Farben – Schwarz, Grau, Ocker und Weiß – erzählt: Die Brüder wurden während der deutschen Besatzung an insgesamt 13 verschiedenen Orten versteckt bzw. unter falschen Namen untergebracht.
Nicht nur die mitunter dramatisch verlaufenden Versteckwechsel überforderten die Buben, genauso tat es die Umstellung auf immer wieder neue Umgebungen. Dabei war jeweils nicht nur ihr eigenes, sondern auch das Leben derer in Gefahr, die sie versteckten. Gilad Seliktar, der es hier mit zwei Erzählern zu tun hat, glättet keineswegs den Umstand, dass sich die Erinnerungen der Brüder an das – vermeintlich parallel – Erlebte mitunter ziemlich unterscheiden.
Was es in „Aber ich lebe“ insgesamt zu entdecken gibt, sind Erinnerungsstimmen und -bilder, die bisher noch nicht oft zu hören oder zu sehen waren: nämlich die von Menschen, die den Holocaust als Kinder überlebt haben.



