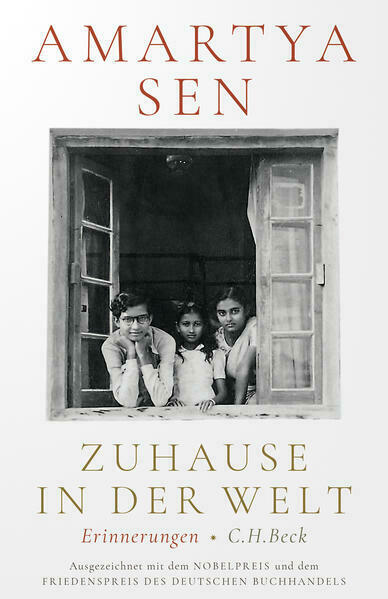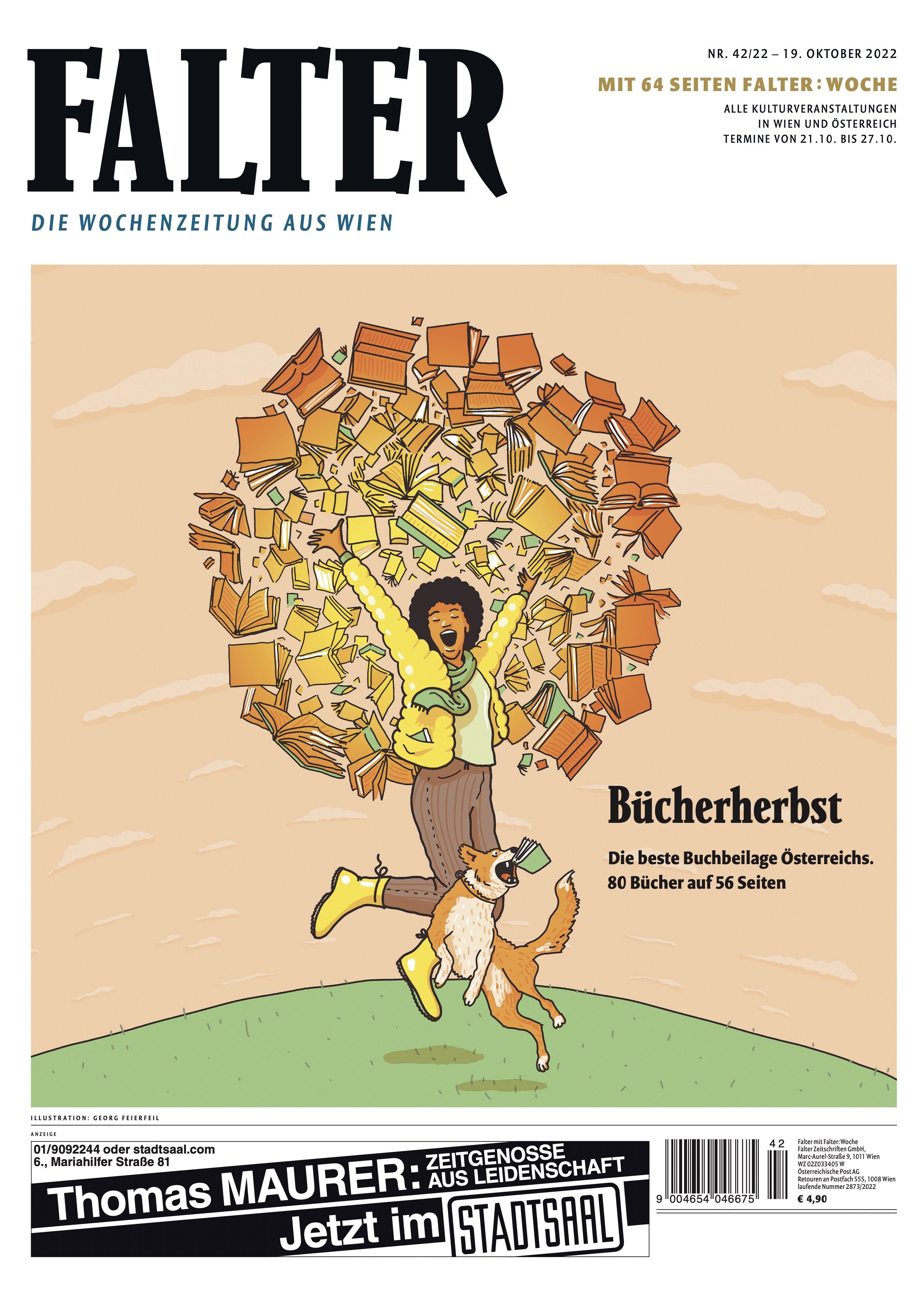
Von Kalkutta nach Cambridge
Alfred Pfoser in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 52)
Als Amartya Sen 1956, noch nicht einmal 23 Jahre alt und ohne Promotion, von einer neuen Universität im indischen Kalkutta gebeten wurde, eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät aufbauen zu helfen, gab es Gegenwind. Mit viel Humor berichtet er in seiner Autobiografie mit dem treffenden Titel „Zu Hause in der Welt“ von einer in einer Studentenzeitschrift veröffentlichten Karikatur, die zeigte, wie er aus der Wiege herausgerissen und direkt zum Professor gemacht wurde.
Seine akademische Vita ist in der Tat imposant. 1933 in eine indische Gelehrtendynastie geboren, war Amartya Sen ein wissenschaftliches Wunderkind. Im Rückblick scheint es, dass er, ausgehend von seiner westbengalischen Heimat, fast mühelos an die renommiertesten Universitäten der Welt (Cambridge, Oxford, London School of Economics, Stanford, Harvard) gelangte. Dazwischen wirkte er acht Jahre an der Universität Delhi. Sein Spezialgebiet waren die Wirtschaftswissenschaften, zu deren Weiterentwicklung er bedeutende Beiträge leistete. Für seine Bücher zur Wohlfahrtsökonomie und Sozialwahltheorie wurde ihm 1998 der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften zuerkannt. Stets stand er quer zur etablierten Ökonomie, hielt sich aus dem Streit zwischen Keynesianern und Neo-Klassikern heraus und ging eigene Wege in seiner Beschäftigung mit ökonomischer Ungleichheit, Armut und rationalen bzw. demokratischen Auswahlverfahren.
Der vierte Teil der Autobiografie gibt ausführlich Einblick in die akademische Karriere, liefert (meist sehr freundliche) Porträts der ihn prägenden Scientific Community – das ist wohl eher für einen kleineren Teil der Leserschaft interessant. Für die Wittgenstein-Gemeinde wird das schöne Charakterbild des italienischen Marxisten Piero Sraffa von Bedeutung sein, weil dieser in Cambridge nicht nur die Wende zur Sprachphilosophie im Denken des großen Philosophen stark beeinflusste, sondern als „director of studies“ auch die Formierung von Sens Denken.
Gerne hätte man nicht nur für diese Lebensphase mehr über Gefühle und Irritationen gelesen und etwas undiplomatischere Einblicke in das universitäre Hickhack als auch das Alltags- und Eheleben gelesen. Aber da lässt uns der nette Sen meist wenig reinschauen. Seine langjährige Gefährtin Martha Nussbaum, eine bekannte Philosophin, kommt überhaupt nicht vor. Selbst in der Beschreibung seiner Kindheit und Jugend fehlt Sen die psychologische Raffinesse. Umso mehr wirkt der soziologische Blick früh entwickelt.
Der weltgewandte Forscher hat bereits früher mit mehreren Büchern bewiesen, dass er gut und locker formulieren kann und die Fähigkeit besitzt, politische und soziale Fragen mit Witz und enormem Wissen anschaulich für eine breite Öffentlichkeit zu erörtern. Nicht zufällig wurde ihm 2020 der Friedenspreis des deutschen Buchhandels überreicht. Die Autobiografie zeigt sich ebenso gut lesbar. Fast im Plauderton schreibt er über die Prägungen der indischen Kindheit, über die so besondere Schule in Santiniketan (geleitet vom Schriftsteller Rabindrarath Tagore) und die Studienjahre in Kalkutta, die ihn in seinem Denken und Forschen zu dem gemacht haben, wofür er heute in der Öffentlichkeit steht.
Mit dem Buch „Die Identitätsfalle“ (Deutsch 2007) verwehrte sich Sen energisch dagegen, Philosophie, Religion oder Geschichte für einen Kampf der Kulturen zu vereinnahmen. Auch in der Autobiografie plädiert er mit Nachdruck für eine multiple Identität.
Noch immer meldet sich bei ihm der Schmerz, dass sich das große Indien 1948 unter dem Einfluss der politischen Hassprediger in einen hinduistischen Teil (Indien) und zwei muslimische Teile (West- und Ost-Pakistan) aufgespalten hat, mit dem „Kollateralschaden“ von einer Million Toten und 15 Millionen Vertriebenen. Sen war nie bereit, diese Teilung zu akzeptieren, und polemisiert gegen den gegenwärtigen Hindu-Nationalismus. In seiner Kindheit habe er erlebt, wie Hindus und Muslime einträchtig zusammen- oder nebeneinanderlebten, von ganz anderen Sorgen geplagt.
Die Mittelschicht hatte die Katastrophe lange Zeit nicht wahrgenommen, auch der zehnjährige Knabe nicht, bis schließlich unübersehbar ausgezehrte Gestalten durchs Land zogen und auf Kalkuttas Straßen zehntausende Menschen starben. Ab 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, grassierte im westbengalischen Indien wegen gestiegener Lebensmittelpreise eine Hungersnot, die zwei bis drei Millionen der ganz Armen dahinraffte. Die britische Zensur sorgte dafür, dass über das Elend ein Mantel des Schweigens gebreitet wurde. Später sollte Sen eine große Studie über das Entstehen von Hungersnöten schreiben.
Der Niedergang des britischen Empire zeichnete sich während Sens Schulzeit ab. Repression war allgegenwärtig. Etliche seiner Onkel wurden von den Kolonialbehörden unter Präventivverdacht ins Gefängnis geworfen, Familienbesuche dorthin gehörten zu seinen frühen Erfahrungen. Bitter stellt er fest, dass Großbritannien 1945 mit der Einführung des Nationalen Gesundheitsdienstes den Sozialstaat begründete, in der Kronkolonie aber von einer solchen Politik nichts wissen wollte. Genauso wenig kümmerte die Briten der grassierende Analphabetismus. Sen verschweigt aber nicht, dass Indien mit Kastenwesen und Feudalismus seine eigene Tradition der Ungleichheit besitzt (nachzulesen in seinem tollen Buch „Indien“).
Auch ein Thema dieser Autobiografie: die Gleichzeitigkeit von indischem und westlichem Denken, die mögliche gegenseitige Bereicherung. Sen beherrscht den selbstverständlichen Umgang mit den klassischen philosophischen Denkern von Adam Smith über David Hume bis Karl Marx, er nimmt Stellung zu den großen wirtschaftswissenschaftlichen Debatten der Gegenwart. Gleichzeitig schöpft er aus dem großen kulturellen und wissenschaftlichen Erbe Indiens wie der altindischen Sprache Sanskrit und alten indischen Epen. Sen sorgte dafür, dass ein Buch seines Großvaters über den Hinduismus wieder erschien. Welch Weite und Offenheit in dieser intellektuellen Autobiografie!