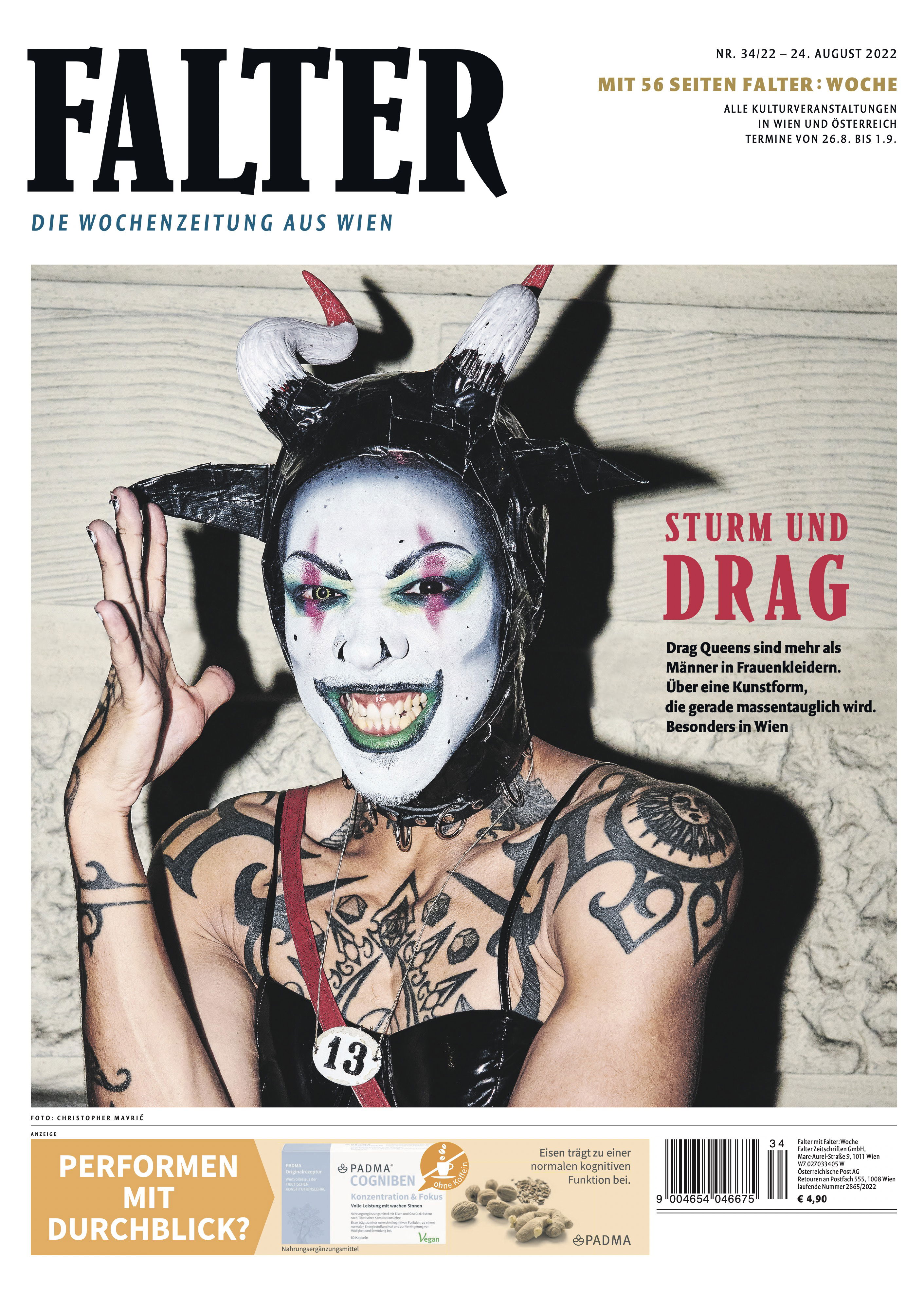
Auf dem Weg zu mehr Gleichheit
Markus Marterbauer in FALTER 34/2022 vom 26.08.2022 (S. 22)
Thomas Piketty ist der wohl einflussreichste Ökonom der Gegenwart. "Eine kurze Geschichte der Gleichheit" erscheint am 25. August
Er schreibt millionenfach verkaufte Beststeller und in den Fachjournalen der Wirtschaftswissenschaft; er schlägt konkrete gesellschaftsverändernde Politik vor und revolutioniert die Verteilungsforschung. Thomas Pikettys "Eine kurze Geschichte der Gleichheit" ist eine Kurzfassung seiner Standardwerke "Kapital im 21. Jahrhundert" (2014) und "Kapital und Ideologie" (2020), aber sie ist mehr als das. Beschrieben die beiden Bücher Ursachen und ideologische Absicherung der Vermögenskonzentration in den Händen weniger, geht es nun um die Entwicklung zu mehr Gleichheit.
Dabei zeigt sich Piketty als "radikaler Optimist" (Falter 11/2020). Er sieht die Geschichte trotz aller Ungerechtigkeiten als Entwicklung hin zu mehr Gleichheit. Etwa wenn es um die Dekonzentration von Vermögen geht: Der Anteil des reichsten Prozents am Vermögen lag in Frankreich von 1780 bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs bei mehr als der Hälfte. Bis 1980 wurde er unter 20 Prozent gedrückt, als Folge von Kriegen und Wirtschaftskrisen, aber auch des Aufstiegs der Arbeiterklasse, die in politischen Kämpfen mehr Gleichheit und Freiheit errang. Ungleichheit ist nicht die Folge ökonomischer Gesetze, sondern ideologischer Weichenstellungen und menschlicher Entscheidungen. Um Entscheidungsmacht zu erlangen, muss man aus der Vergangenheit lernen.
Militärische Übermacht, Kolonialismus, Sklaverei, Protektionismus und Ausbeutung des Planeten waren bestimmend für die europäische Dominanz auf den Weltmärkten und den Reichtum der europäischen Eliten. Soziale Kämpfe in Europa und den Kolonien beendeten diese Dominanz und reduzierten den wirtschaftlichen und politischen Einfluss der Vermögenden. Diese Erfolge waren ambivalent, selbst nach der Abschaffung der Sklaverei wurden nicht die Opfer, sondern die britischen und französischen Sklavenhalter für ihren Verlust entschädigt. Die Spuren der Sklaverei prägen noch heute Vermögensverhältnisse und Gesellschaften. Reparationsleistungen sind offen, die Frage von Gleichheit und Demokratie stellt sich in den weltwirtschaftlichen Beziehungen. Schweden zählte noch 1900 zu den ungleichsten Gesellschaften Europas. Das extreme Zensuswahlrecht gab einem vermögenden Fabriks-oder Grundbesitzer bei Gemeindewahlen mehr als die Hälfte aller Stimmen. Die staatlichen Institutionen dienten den Interessen der Reichen. Doch innerhalb weniger Jahrzehnte wurde Schweden zu einer der egalitärsten Gesellschaften der Welt. Sozialdemokratie und Gewerkschaften erkämpften Demokratie, Wohlfahrtsstaat und progressive Steuern. Der Staat wurde zum Instrument der arbeitenden Bevölkerung.
Progressive Steuern auf Einkommen, Vermögen und Erbschaften sowie der Ausbau des Wohlfahrtsstaates sind Kernelemente in Pikettys Projekt eines "demokratischen, ökologischen und multikulturellen Sozialismus". Ein fortschrittliches Projekt braucht auch eine internationale Vision, die die Macht multinationaler Konzerne und der Milliardäre weltweit begrenzt. Piketty entwirft postkoloniale Reparationen, ein globales Vermögensregister und neue Formen internationaler Demokratie, um der globalisierten Wirtschaft Leitplanken zu geben. Covid-und Energiekrise verschärfen Ungleichheit. Während Arme und die arbeitende Bevölkerung verlieren, wachsen Übergewinne der Konzerne und Überreichtum der Milliardäre. Vielleicht ist das ein entscheidender Moment, in dem auf Basis der Erfahrungen vergangener Verteilungskämpfe sozialer Fortschritt erreichbar ist.


