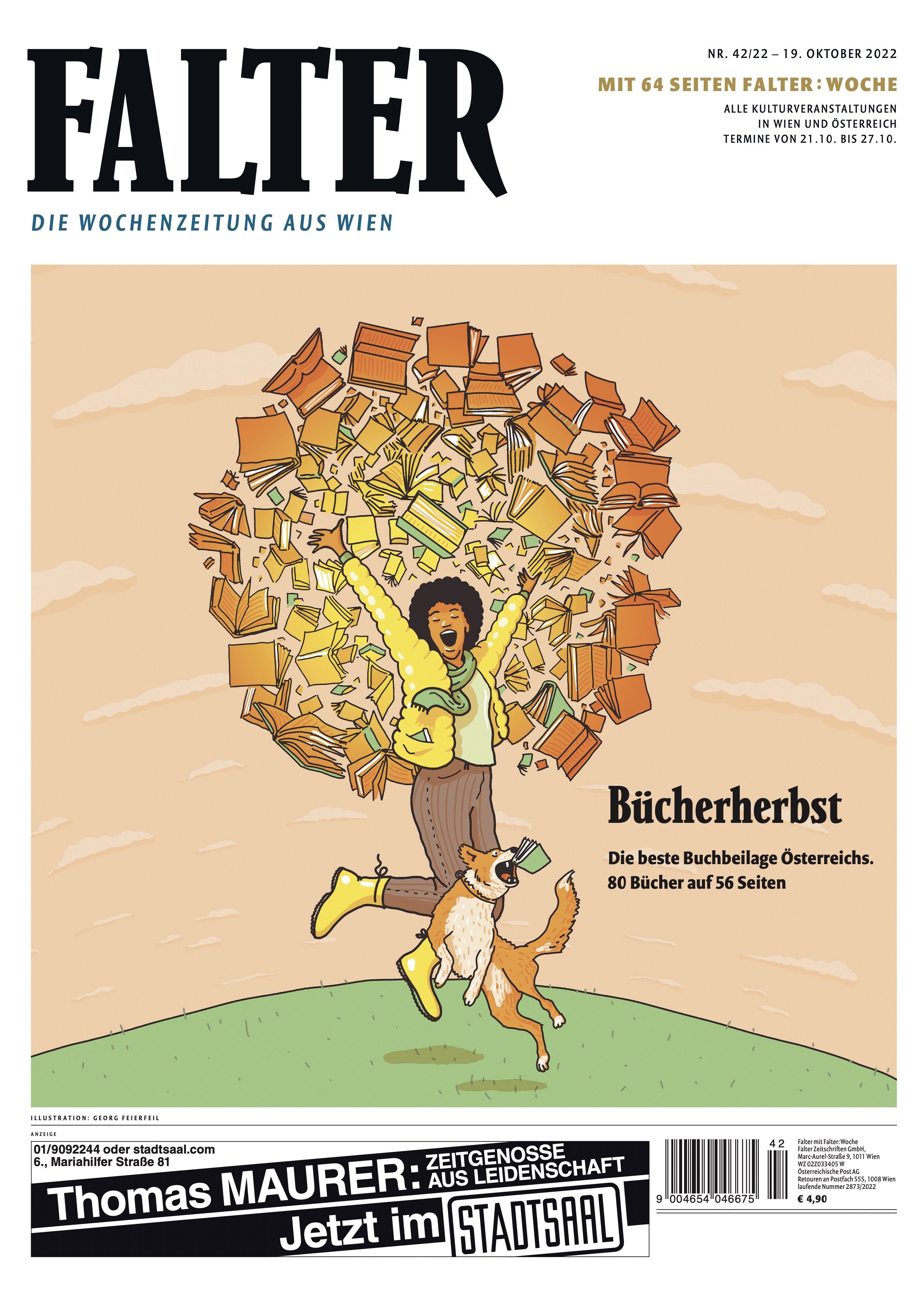
Als die Weimarer Republik aus den Fugen geriet
Alfred Pfoser in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 38)
Jubiläen künden sich durch Bücher an. 1923? Gewiss, bald ist es hundert Jahre her, aber ist das Jahr denn einer genaueren Betrachtung wert? Zwei Bücher über 1923 sind schon erschienen, weitere sind angekündigt. Schon wieder ein Erinnern, das vollmundig mehr verspricht, als es einlösen kann? Erschien da nicht gerade ein Buch, das 1922 zum Jahr des Glücks ausrief? Bei genauerem Hinsehen beschränkte sich dieses Glück auf die Literaturgeschichte. Der deutsche Schriftsteller Norbert Hummelt folgte den Spuren von Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf und Rainer Maria Rilke und meinte, ein Annus mirabilis gefunden zu haben.
Jetzt also Volker Ullrichs „Deutschland 1923. Ein Jahr am Abgrund“ (C. H. Beck) und, eine Spur weniger dramatisch, Peter Reichels „Rettung der Republik? Deutschland im Krisenjahr 1923“ (Hanser). Die zwei Geschichtsbücher, auf Deutschland konzentriert, machen auf klassische Geschichtsschreibung. Aber ist die explosive Rhetorik in den Titeln gerechtfertigt? Verdient es 1923, zum Schlüsseljahr der Weimarer Republik und zum Vorspiel von Hitlers Machtergreifung 1933 stilisiert zu werden?
Der Historiker und Journalist Volker Ullrich, der viele Jahre bei der Zeit für das politische Buch verantwortlich war, breitet das Krisenjahr in einem großen Panorama aus. Durch Porträts und persönliche Geschichten, durch pointierte Zitate aus Tagebüchern und Tageszeitungen stellt er anschauliche Farbigkeit her, was die Lektüre leicht und spannend macht.
1923 bedeutete in seiner Darstellung in der Geschichte der Weimarer Republik eine nie da gewesene Steigerung an Wirrnis und Spannung. Der Publizist Sebastian Haffner, den er zitiert, meinte gar: „Kein Volk der Welt hat erlebt, was dem deutschen 1923-Erlebnis entspricht“.
Denn nicht nur die große Politik geriet aus der Balance. Die ganze Bevölkerung wähnte sich in einem Tollhaus, sah das Land in den Untergang driften, reif für den Ruin.
Beklemmende Ungewissheit im Alltag wurde zum Dauerzustand, jede Stabilität war verloren. Die Tagebuchschreiber beklagten, dass man sich auf nichts mehr verlassen, sich an nichts mehr halten konnte. „Die Zeit ist allzu sehr aus den Fugen“, notierte etwa der Romanist Victor Klemperer Ende Mai 1923, Anfang September klagte er: „Jeder fühlt etwas Bedrohlichstes in nächster Nähe, niemand weiß, was wird.“
In der Chronik der Ereignisse mangelte es dem Jahr 1923 also wahrlich nicht an Spannung. Straßenkämpfe und Aufstände, Umsturzversuche und Verschwörungen, Regierungs- und Parteikrisen hielten die politischen Eliten wie das Land in steter Spannung.
Es begann mit der französischen Besetzung des Ruhrgebietes (11. Januar), die aus Versäumnissen in der Zahlung der Reparationen resultierte; was folgte, waren passiver Widerstand vor Ort, wilde Streiks, gewaltsame Zusammenstöße, Gerichtsprozesse und Ausweisungen Zehntausender, was in ganz Deutschland eine nationalistische Dauererregung auslöste.
Der Erste Weltkrieg schien in den deutsch-französischen Auseinandersetzung eine Fortsetzung zu erhalten. Und das Jahr war noch nicht zu Ende, als Adolf Hitler, zusammen mit der Weltkriegslegende Erich Ludendorff, durch einen Putsch im Münchner Bürgerbräukeller (8. November) einen „Marsch auf Berlin“ anstoßen wollte.
Hitler war damals aber nicht der Einzige aus den völkisch-nationalistischen Kreisen, die in diesem Jahr eine Chance zur Machtübernahme witterten. Kurz vorher hatte sich die gegenrevolutionäre Landesregierung des Freistaats Bayern damit profiliert, den Anordnungen Berlins und dem Republikgesetz die Stirn zu bieten. Auch die deutschen Kommunisten waren der Ansicht, im revolutionären Endkampf zu stehen, und rechneten sich, ausgehend von einer rot-roten Regierung in Sachsen und Thüringen, eine Machtübernahme aus. Überdies rüttelten separatistische Bewegungen entlang des Rheins an der Einheit des Reiches.
Begleitet und befeuert wurde die politische Hochspannung durch eine galoppierende Inflation, die die Ersparnisse in Nichts auflöste und den Wert von Gehältern und Renten innerhalb von Stunden dahinschmelzen ließ. Das Geld möglichst schnell auszugeben, bevor es an Kaufkraft verlor, wurde zu einer Überlebensfrage. Reis, der gestern pro Pfund 80.000 Mark kostete, war am nächsten Tag nur mehr um 160.000 Mark zu haben.
Der Zahlenwahnsinn fraß sich in die Hirne, bestimmte das alltägliche Denken, führte zu Spekulationsfieber und Prasserei. Die Hyperinflation, an deren Ende das Brot eineinhalb Milliarden Mark kostete, zerriss den Zusammenhalt der Gesellschaft, machte vor allem den Mittelstand zu Verlierern.
Noch im Dezember 1923 schien die Weimarer Republik verloren; aber Reichspräsident Friedrich Ebert und Reichskanzler Gustav Stresemann gelang in den nächsten Monaten das Kunststück, erfolgreich durch die Krise zu steuern. Die Währung wurde saniert, der Ruhrkampf wurde abgeblasen, Deutschland konnte sich unter veränderten internationalen Konstellationen mit den Alliierten in der Reparationenfrage einigen, in der innenpolitischen Auseinandersetzung trat eine gewisse Beruhigung ein. Die Jahre, die folgten, gelten als die glücklichsten in der Geschichte der Weimarer Republik.
Aber war in den Golden Twenties alles gut?
Peter Reichel zeigt anschaulich, wie erbittert und risikoreich der Kampf um die Macht geführt wurde, wie knapp der Wettlauf um eine Stabilisierung war und welche persönlichen Wunden die Krise von 1923 schlug. Die Politiker an der Spitze des Staates waren groben Beleidigungen und Demütigungen ausgesetzt: Ebert musste erleben, wie ihm ein Gericht zur Freude der Rechten Hochverrat attestierte, weil er sich im Jänner 1918 in der Streikführung engagiert hatte. Die Rede von den „Novemberverbrechern“, der rechtsradikalen Lieblingsbezeichnung für die Gründer der Republik, wurde damit quasi gerichtlich bestätigt. Der Stress hatte Folgen: Friedrich Ebert starb frühzeitig im Alter von 54, Gustav Stresemann mit 51 Jahren.
1923 wurde sichtbar, welche Instrumente die Weimarer Verfassung dem Schaltraum der Republik zur Verfügung stellte. Ebert wendete das Instrument des Ermächtigungsgesetzes an und schaltete in der Notsituation die Reichswehr ein. Der politische Gegner mit seinen Bastionen in Reichswehr, Verwaltung und Justiz lernte, welch große Bedeutung das Amt des Reichspräsidenten barg, und hielt Ausschau nach einem populären Kandidaten, um das Präsidentenamt zu erobern.
1925 war es dann so weit. Nach dem überraschenden Tod Eberts wurde die Wahl vorzeitig notwendig. Der Kandidat des antirepublikanischen „Reichsblocks“, der greise Feldmarschall Paul von Hindenburg, gewann. Als die Weltwirtschaftskrise die politische Mitte dezimierte, schlug seine Stunde – mit den bekannten Folgen.
Was leisten die beiden Bücher im Vergleich? In der Tendenz sind sie ähnlich, beide haben ihre Vorzüge. Volker Ullrich inszeniert das „Jahr am Abgrund“ im Überblick; er zeigt, dass er auch Journalismus kann. Peter Reichels Darstellung ist viel enger gefasst, auch kürzer, und kümmert sich in der Analyse vor allem um die Funktionsweise der Republik. Trotzdem leistet er sich überraschenderweise einen langen Exkurs zur Münchner Räterepublik, um das Besondere des bayrischen Anteils an der Geschichte herauszustreichen. Hitler wurde bekanntlich in München groß und nicht in Berlin.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen:



