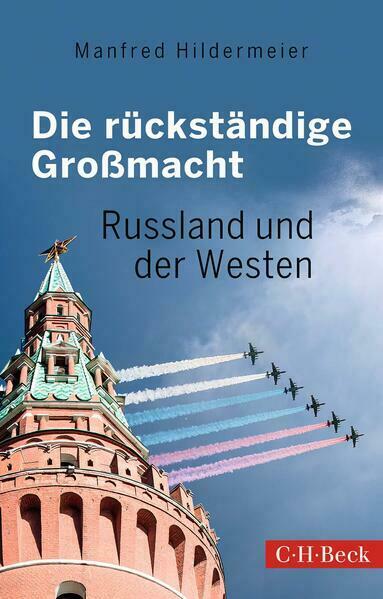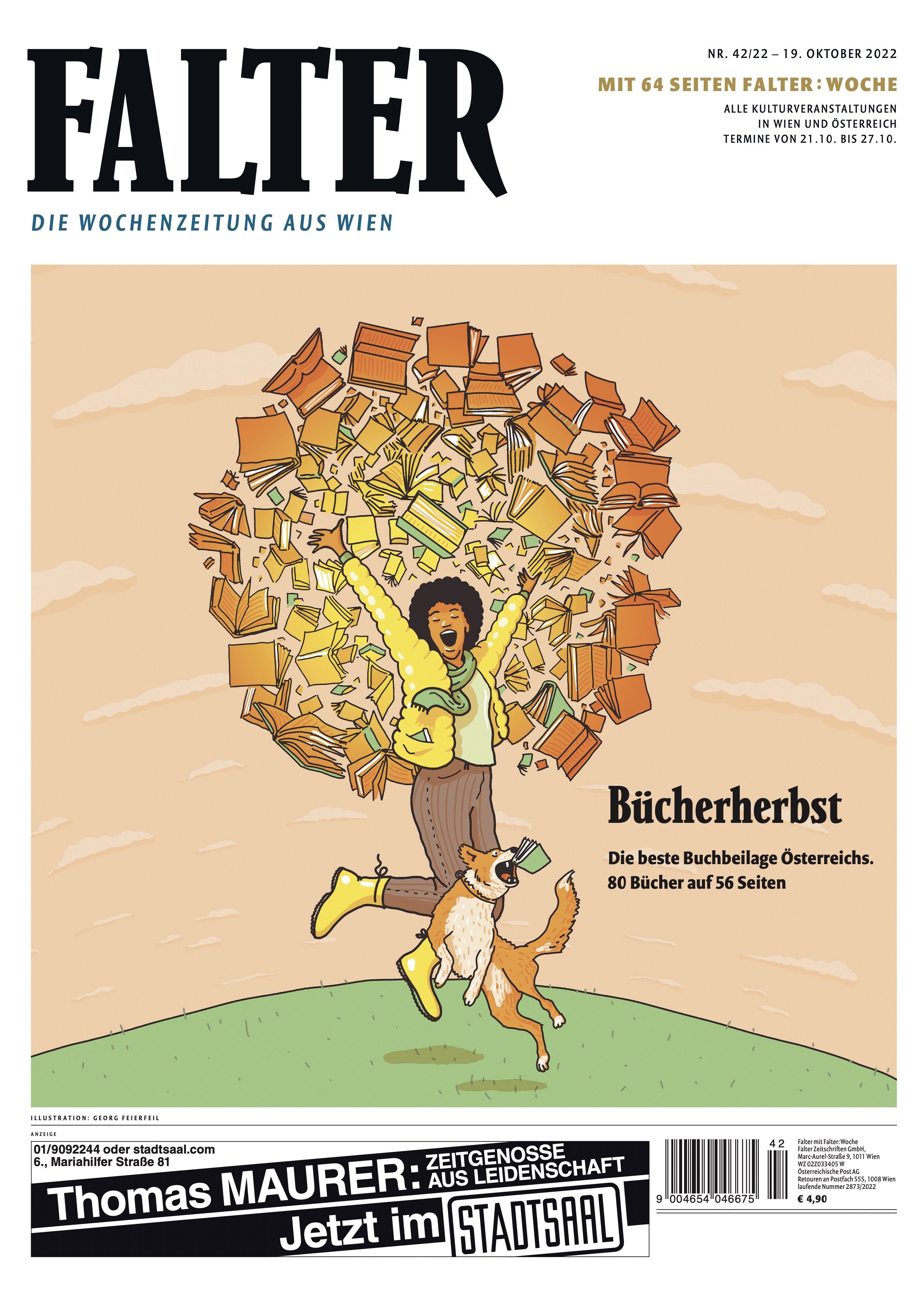
Geliebt, beneidet, bekämpft
Erich Klein in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 43)
Putin- und Russlanderklärer haben Konjunktur. Wenn sich Journalisten, Politologen und diverse Kreml-Experten wie im Zuge des aktuellen Ukrainekrieges nicht mehr auskennen, haben die Historiker das Wort. Einer der profundesten Russlandkenner, der Historiker Manfred Hildermeier, bekennt in seiner Studie mit dem bezeichnenden Titel „Die rückständige Großmacht. Russland und der Westen“ gleich eingangs unumwunden: Das Konzept „Rückständigkeit“ sei wohl umstritten, vielleicht auch veraltet, bislang sei aber kein besserer Begriff gefunden worden, um das asymmetrische Verhältnis zwischen West und Ost zu beschreiben. Die gegenseitige Wahrnehmung war vom Anfang bis herauf in die Gegenwart dergestalt: „Während der Westen sich dabei überwiegend im Gefühl der Überlegenheit sonnte, wurde sie in Russland zum Wechselbad von Hochschätzung und Ablehnung, von Nacheifern und Besinnung auf Eigenständigkeit.“ Der Ansatz mag Ausdruck einer eurozentristischen Position sein, allerdings bringt der Göttinger Historiker ausreichende Belege für das ungleiche Verhältnis.
In acht dicht geschriebenen und gut lesbaren Kapiteln spannt Hildermeier einen Bogen von der so genannten Kiewer Rus, dem Ursprung des russischen Staates (ein Ausdruck von Historikern des 19. Jahrhunderts), bis in die Gegenwart, wobei der „wilde Osten“ anfangs kaum barbarischer als der Westen erscheint. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit handelte es sich um eine religiöse Abgrenzung; den nachhaltigsten Einschnitt stellt die Kirchenspaltung im Großen Schisma von 1054 dar, in dem sich Papst und Patriarch gegenseitig exkommunizierten. Ältesten russischen Chroniken zufolge war der Westen nicht nur Feindesland, der lateinischen Welt wurden auch höchst merkwürdige Eigenschaften zugeschrieben: Eine Brutstätte der Abartigkeit und Unreinheit sei sie, in der man Katzen isst und Urin trinkt. Waren es anfangs Mönche und gelehrter Klerus, die im Osten dieses Bild des Westens formulierten, blieben die im Lauf der Jahrhunderte sich ablösenden Eliten nicht weniger zwiespältig, egal ob es sich um Aristokratie und aufgeklärtes Beamtentum oder die säkulare Intelligenzija des 19. Jahrhunderts handelte. Bewunderung und Ablehnung gingen stets Hand in Hand.
Das hinderte weder das Fürstentum Novgorod daran, Handel mit dem Westen zu treiben, noch Iwan III., sich an der Wende zum 16. Jahrhundert italienische Architekten ins Land zu holen, um etwa den Moskauer Kreml, wie man ihn heute noch kennt, zu bauen. Über Jahrhunderte wurden aus Europa Handwerker, Bergbauspezialisten, Wundärzte und Militärexperten in russische Dienste geholt; gelegentlich auch gegen den Widerstand der Ortsansässigen, da die Ausländer mit Privilegien gelockt wurden.
Der mächtigste Gegner des Wissenstransfers, die orthodoxe Kirche, wurde von Peter dem Großen in die Schranken gewiesen, worauf diese ihn sogleich zum „Antichristen“ erklärte. Mit der Gründung Sankt Petersburgs war die Öffnung zum Westen nicht mehr aufzuhalten. Der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz wurde als Berater bei der Gründung der Akademie der Wissenschaften gewonnen, noch mehr europäische Experten kamen ins Land, um die Industrie aufzubauen, ebenso Militärs, um die Expansion des Zarenreiches fortzusetzen. Die berühmte Bartsteuer hatte zu entrichten, wer sich nicht zum zivilisierten Europäer rasierte. In der Ära von Katharina der Großen setzten sogenannte Bildungsreisen nach Westeuropa ein: „Ein neuer Adeliger kathariänischer Prägung war beides zugleich – Kosmopolit nach Maßstäben der Zeit, i.e. Europäer und Russe.“
Besonderes Augenmerk schenkt der Historiker den Reformdiskussionen des 19. Jahrhunderts, beginnend mit dem Philosophen Pjotr Tschadajew, der Russland als zivilisatorische Tabula rasa ansah: Das Land sei „geistig vollständig unbedeutend“, die Verantwortung dafür verortet er bei der Kirche. Zar Nikolaus I. erklärt den Denker postwendend für verrückt. Im Zuge der Diskussionen zwischen „Slawophilen“ und „Westlern“ und vor allem nach der Niederlage der diversen europäischen Revolutionen des Jahres 1848 setzt sich auch in der russischen Intelligenzija das Bild eines verrotteten Westens durch. Diverse Spielarten eines slawischen Urkommunismus entzünden die Geister. Umfangreiche Reformen finden erst im Gefolge von Russlands Niederlage im ersten gesamteuropäischen Krieg, dem Krimkrieg, statt (1853–1856): Bauernbefreiung, Industrialisierung durch Eisenbahnbau, Schaffung von Schwerindustrie.
Am Vorabend des Ersten Weltkrieges stellt Russland zumindest in kultureller Hinsicht eine Großmacht dar – das Petersburger „Laboratorium der Modernen“ wird sprichwörtlich, die ersten bedeutenden Sammler von Picasso und Matisse sind Kaufleute aus Moskau. Mit dem Sieg des Sozialismus in der sogenannten Oktoberrevolution wird der Anspruch, Rückständigkeit gegenüber dem Westen aufzuholen, ins Gegenteil verkehrt – im russischen Selbstverständnis hat sich der Weltgeist des Fortschritts in der Sowjetunion niedergelassen.
Als diese untergeht, werden Europa und Nordamerika zwar wiederum zum Symbol von Freiheit und materiellem Wohlstand, doch das Pendel schlägt abermals nach der entgegengesetzten Seite aus: „Die autoritär-konservative, von nationalistischen Tönen begleitete Wende unter Putin wiederholt in vielerlei Hinsicht nur ein bekanntes historisches Muster.“ Manfred Hildermeiers im besten Sinne „sine ira et studio“ – ohne Zorn und Eifer – verfasstes Buch ist eines der besten, die man derzeit über Russland lesen kann.