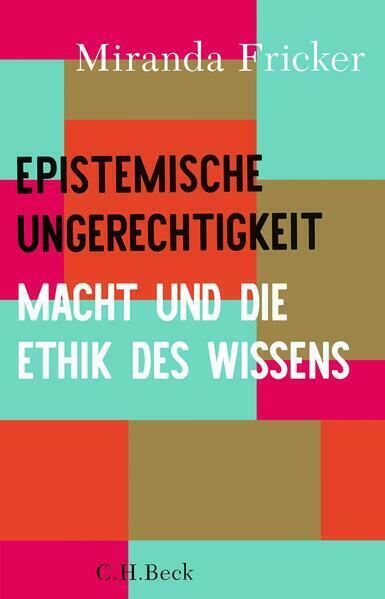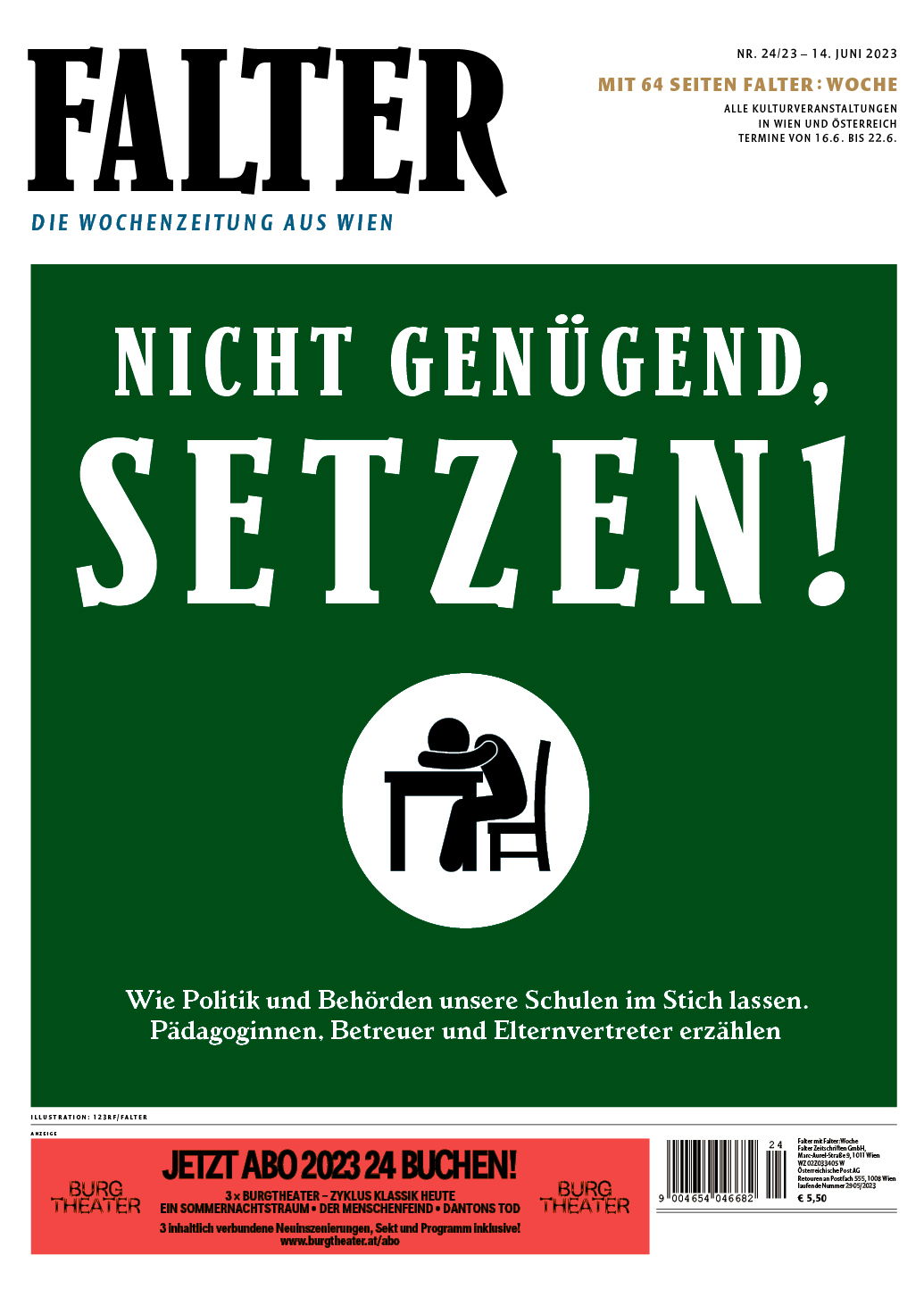
Die Tugend der Wahrnehmung
Alfred Pfabigan in FALTER 24/2023 vom 14.06.2023 (S. 20)
Miranda Fricker, geboren 1966, Oxford-Absolventin und derzeit Professorin an der New York University, hat in ihrem 2007 erschienenen Erstling, der mittlerweile als moderner Klassiker gilt, zwei Begriffe in die Diskussion eingebracht: epistemische und hermeneutische Ungerechtigkeit.
"Epistemische", also erkenntnismäßige Ungerechtigkeit liegt dann vor, wenn eine Person oder eine Gruppe, die über ein gesichertes, nachvollziehbares Wissen verfügt, nicht ernst genommen wird. Vorurteile und verinnerlichte Stereotypen reduzieren die "Credibility". Sie findet statt, wenn beispielsweise Frauen, migrantischen Gemeinschaften oder der Bevölkerung ganzer Kontinente die Fähigkeit abgesprochen wird, relevantes Wissen zu erlangen und verlässliche Wahrnehmungen mitzuteilen.
Hermeneutische Ungerechtigkeit passiert, wenn durch eine "Lücke in unseren kollektiven hermeneutischen Ressourcen" Menschen nicht fähig sind, ihre Erfahrungen zu begreifen und zu vermitteln.
Die Autorin wurde nicht zu Unrecht der feministischen Philosophie zugerechnet, dort sind ihre Begriffe auch selbstverständlich geworden. Aber es gibt Beispiele, die weiter gehen. Denken wir nur an die Angehörigen der NSU-Opfer, wo die Ermittler aufgrund des Migrationshintergrundes der Opfer hartnäckig lange Zeit die politische Dimension des Falles ignorierten. Oder die #metoo-Bewegung.
Fricker erklärt sich das lange Schweigen über sexuelle Belästigungen als Folge des Fehlens eines milieuübergreifend akzeptierten Begriffes sexueller Belästigung. Nicht nur das Publikum, auch die Opfer hätten Schwierigkeiten in der Deutung der Situation gehabt. War es nicht doch nur ein gescheiterter Flirt, eine Alltäglichkeit, Folge einer Provokation oder einfach Unvorsichtigkeit?
So eine "Zeugnisungerechtigkeit" kann uns allen widerfahren. Frickers Antwort darauf: eine "Tugend der Wahrnehmung" gegen vorurteilshaft verzerrte Erkenntnis.