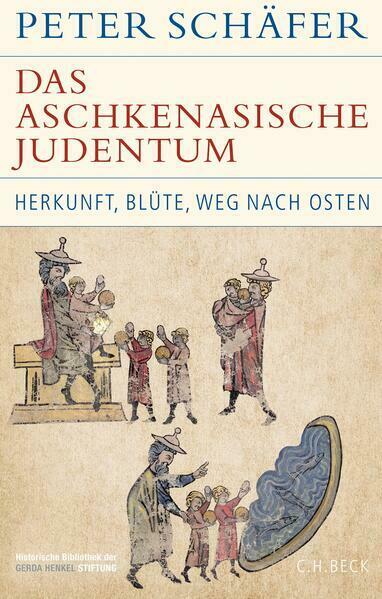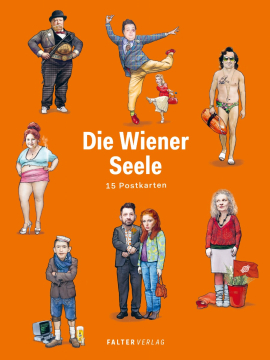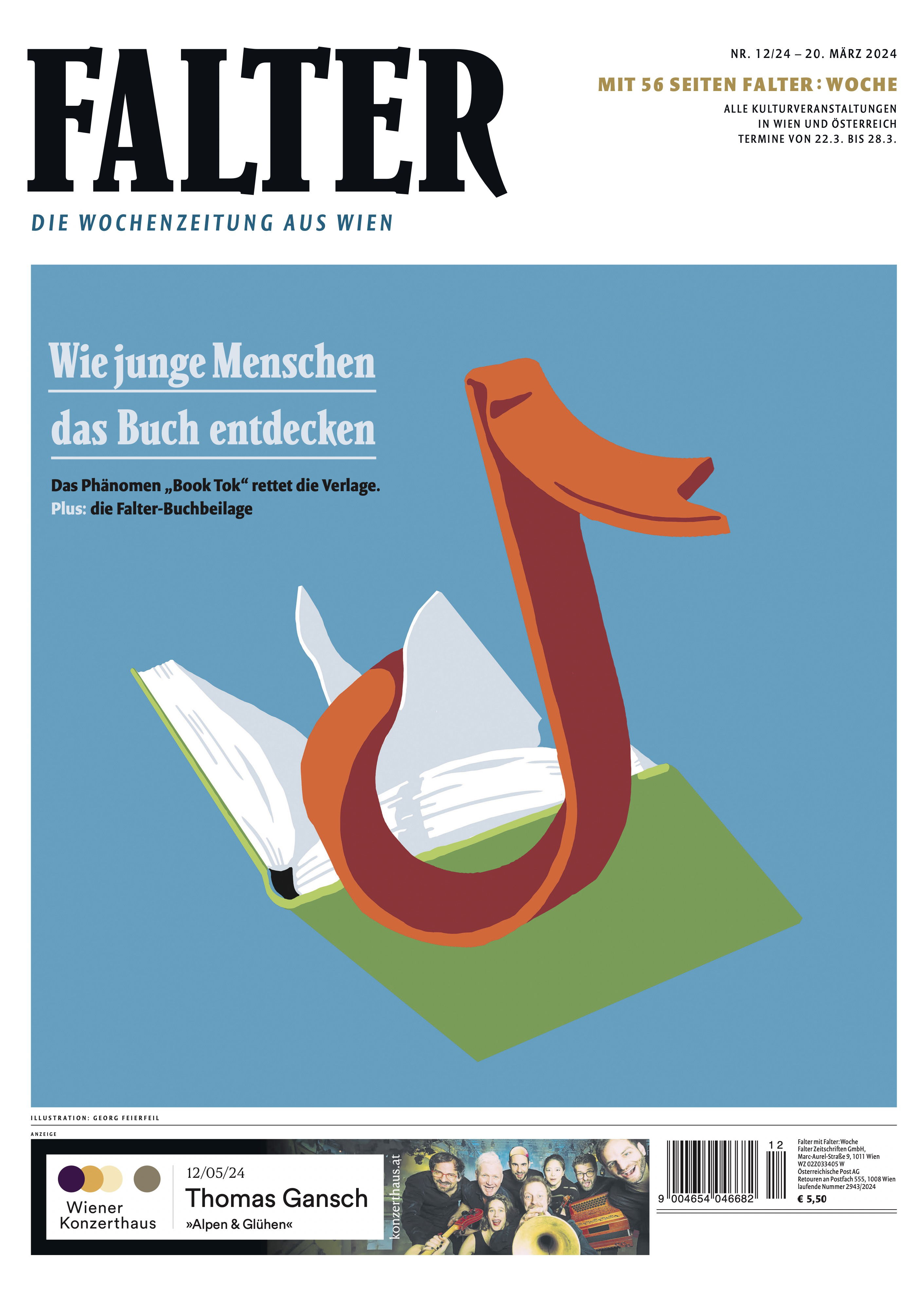
Von Köln bis Odessa und Jerusalem
Thomas Leitner in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 28)
Aschkenas“ bedeutet Norden: So bezeichneten die Aschkenasen, also die seit dem Mittelalter in Europa ansässigen Juden, ihren Lebensraum in Deutschland. Ihnen widmet Peter Schäfer, der in Köln, Berlin und Princeton lehrte und am Ende der wissenschaftlichen Karriere bis 2019 das Jüdische Museum in Berlin leitete, sein Opus magnum. Wie alle bisherigen Werke zeichnet es sich durch klare Sprache, Differenziertheit und kreative Kombinatorik aus.
Das Grundanliegen des Werks „Das aschkenasische Judentum“ ist es, die Vielgestaltigkeit des Judentums von der Antike bis zur Neuzeit hervorzuheben. Ihm geht Schäfer in filigranen Detailstudien und weiten Assoziationsbögen nach. Den Kern bildet die Geschichte der deutschen Juden von der karolingischen Zeit (ab dem 9. Jahrhundert) bis zur Shoah, abschließende Betrachtungen reichen bis in die Gegenwart Israels und zur Diaspora.
Um die Mentalität und geistige Tradition der vor allem im Rheinland siedelnden Juden des Hochmittelalters zu begreifen, holt Schäfer weit aus, bis zu theologischen Formationsprozessen im Alten Testament. Auch setzt er sich mit der geistigen Welt der klassischen Antike in den römischen Kolonien auseinander. Dabei baut er aufsehenerregende Gedankengänge früherer Werke ein: So war der Monotheismus nicht von Anfang an im Glauben festgeschrieben. Sogar die christliche Trinitätslehre hinterließ in neueren theologischen Strömungen des 3. Jahrhunderts Spuren.
Das Zentrum der Aschkenasen waren Köln und die drei Gemeinden von Mainz, Speyer und Worms. Ab dem 11. Jahrhundert entwickelte sich hier ein reges jüdisches Leben, geistig wie wirtschaftlich. Im prekären Gleichgewicht von weltlicher (kaiserlicher, kommunaler) und kirchlicher Macht folgten in raschem Wechsel Blütezeiten und Katastrophen.
Ins kollektive Gedächtnis brannten sich die Pogrome während der Kreuzzüge ein, vor allem jener von 1096: Als Auftakt des Kriegs gegen den Islam wurden zunächst die einheimischen Andersgläubigen verfolgt. In der großen Pestepidemie um 1350 mussten Juden als Sündenböcke herhalten und wurden als „Brunnenvergifter“ verleumdet.
Eindrucksvoll die Regenerationsfähigkeit, mit der sie die von Gewinnsucht und Aberglauben angefachten Vernichtungswellen überwanden. Peter Schäfer legt Wert darauf, nicht in die, wie er es nennt, „tränenreiche Geschichte“ zu verfallen, die das Opfersein in den Mittelpunkt stellt, er betont vielmehr die kulturellen Leistungen als Reaktion darauf.
Aber bei allem Widerstand: Ab dem 18. Jahrhundert wurden die Juden über Prag und Wien mehr und mehr in den Raum zwischen Warschau und Odessa verdrängt. Dort nahm ihre Kultur ein anderes Gesicht an, das des Chassidismus, der ländlicher und von ausgeprägter Frömmigkeit war. Die Schilderung dieser mystischen Strömungen im 19. Jahrhundert bildet eines der faszinierendsten Kapitel des Buches – auch weil deren Einflüsse im heutigen Alltag von Israel bis New York spürbar sind. Sekten bildeten sich heraus, neben dem strikt geregelten täglichen Leben stand esoterisches Feiern, geprägt von Tanz und Gesang. Bis heute treten die Führer solcher Gemeinden als Autoritäten auf.
In Osteuropa wiederum wurden die Juden als mit der Obrigkeit verbundene Kolonisatoren wahrgenommen, was zu immer häufigerer und heftigerer Verfolgung führte. Aus dieser Bedrohung erwuchsen weltliche Befreiungsansätze: Während die im 19. Jahrhundert in deutschen Städten wieder angesiedelten Juden sich der bürgerlichen Aufklärung anschlossen und dadurch Assimilierung eintrat, fand im Osten neben einem jüdischen Sozialismus der Zionismus seine Anhänger. Diese sahen in Palästina (der ursprünglichen Heimat, einem Raum, zu dem die Beziehung nie ganz abgebrochen war) die einzige Möglichkeit einer gesicherten Zukunft. Eine Illusion?