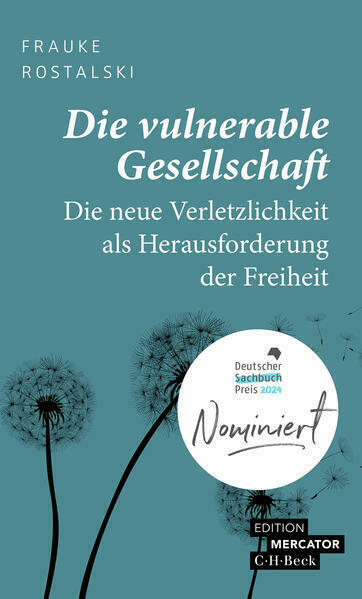"Der Staat soll das für mich regeln!"
Klaus Nüchtern in FALTER 30/2024 vom 24.07.2024 (S. 25)
Als Opfer anerkannt zu werden und somit Wiedergutmachungsansprüche stellen zu können ist, historisch betrachtet, ein ziemlich junges Phänomen. Als man 1833 im Britischen Empire die Sklaverei abschaffte, wurden bekanntlich nicht die Sklaven, sondern deren Besitzer entschädigt.
Die Aufarbeitung von Diskriminierung entlang von Kategorien wie Geschlecht, ethnischer und Klassenzugehörigkeit, Alter, sexueller Orientierung et al. ist aber längst keine Sache der "Vergangenheitsbewältigung" mehr, sondern in der Gegenwart angekommen, ja alltäglich geworden: Immer mehr Menschen fühlen sich missachtet und ausgegrenzt. In ihrem gut lesbaren und angenehm unpolemischen Buch "Die vulnerable Gesellschaft" reflektiert die deutsche Juristin Frauke Rostalski das Phänomen der "neuen Verletzlichkeit" und geht der Frage nach, welche Konsequenzen der immer lauter werdende Ruf nach staatlichen Schutzmaßnahmen hat.
Falter: Frau Rostalski, ist der Begriff der "Vulnerabilität" ein Kind der Pandemie?
Frauke Rostalski: Nein. Der Diskurs über Vulnerabilität wurde zunächst einmal Fachdisziplinen wie Medizin und Philosophie überlassen. Mit der Pandemie aber ist er in den allgemeinen Sprachgebrauch eingedrungen, und jeder konnte auch sofort etwas damit anfangen. Er wurde allerdings schon während Corona auf immer mehr Bereiche ausgedehnt, und das funktioniert immer auf die gleiche Weise: Vulnerabilität indiziert eine besondere Schutzbedürftigkeit und zugleich einen Auftrag an den Staat.
Der von Ihnen zitierte Soziologe Andreas Reckwitz spricht sogar davon, dass der spätkapitalistische Staat die Vulnerabilität ins Zentrum seines Interesses rückt. Rostalski: Ja, und ich als Juristin interessiere mich dafür, ob und inwiefern sich dieser Trend in der aktuellen -in meinem Falle: deutschen -Rechtslage niederschlägt. Und tatsächlich ist das bereits vielfach der Fall. Das Masernschutzgesetz (seit 1.3.2020 in Kraft, sieht es vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in Kindergarten oder Schule die empfohlenen Impfungen vorweisen, Anm.) ist eine Folge davon, dass die Masern, mit denen wir Jahrzehnte lang leben konnten und gut klargekommen sind, auf einmal neue Schutzbedürftigkeiten hervorbringen.
Die Berufung auf Vulnerabilität tendiert dazu, die Notwendigkeit von Maßnahmen widerspruchslos einzufordern.
Rostalski: Dieser normative Druck, den Sie ansprechen, ist ein wichtiger Punkt. Die Feststellung von Vulnerabilität führt nämlich automatisch zum Schluss: "Jetzt muss der Staat was tun!" Hinzu kommt, dass Vulnerabilität oft sehr einseitig zugeschrieben wird. Tatsächlich aber gibt es unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Vulnerabilitäten -denken wir an die Kinder während der Pandemie, die nicht mehr in die Schule oder auf den Spielplatz durften. Sobald wir den Begriff Vulnerabilität aber nicht mehr rein deskriptiv, sondern normativ verwenden, dürfen wir die Prüfung von Verhältnismäßigkeit nicht einfach außer Kraft setzen.
Was ist aus der Sicht einer Juristin zum Begriff der Verhältnismäßigkeit zu sagen?
Rostalski: Das ist ein verfassungsrechtlicher Grundsatz, der besagt, dass der staatliche Eingriff einen legitimen Zweck erfüllen und dazu geeignet, erforderlich und angemessen sein muss. Es müssen also widerstreitende Interessen in Erwägung gezogen und gegeneinander abgewogen werden. Die Freiheiten, die sich der Staat nimmt, führen nämlich immer dazu, dass jene der Bürgerinnen und Bürger eingeschränkt werden.
Sie widersprechen in Ihrem Buch vehement der weitverbreiteten Auffassung, dass es nur zu einer Umverteilung von Freiheiten kommt.
Rostalski: Genau. Die Idee ist immer, dass den Starken genommen, den Schwachen gegeben werde und es sich dabei um eine Art Nullsummenspiel handle. Das stimmt so aber nicht, denn auch den Schwachen wird etwas genommen, nämlich Eigenverantwortung und die Fähigkeit, Konflikte selbst zu lösen. Der Staat schiebt sich zwischen die Menschen.
Aber doch, um die Schwachen zu schützen?
Rostalski: Ja. Die Schwachen sind damit oft einverstanden und können auf diese Freiheit gut verzichten. Dennoch verlieren auch sie etwas: ihre Eigenverantwortung. Als Juristin muss ich das ganz nüchtern wie eine Rechnung betrachten und feststellen, dass der Einzige, der auf jeden Fall gewinnt, der Staat ist.
Die neuzeitliche Staatstheorie eines Thomas Hobbes beruht genau auf dieser Vertragsvorstellung: Der Bürger verzichtet auf Freiheiten, und der Souverän gewährt ihm dafür Schutz.
Rostalski: Hobbes hat in seinem "Leviathan" aber sehr gut verstanden, dass wir da tatsächlich ein Ungeheuer schaffen. Heute ist man staatstheoretisch weiter und sagt, dass es Aufgabe des Staates ist, zu schützen, aber dabei auch die größtmögliche Freiheit aller zu gewährleisten. Wir bewegen uns immer mehr in Richtung Sicherheitsstaat, weil wir uns selbst so stark als verletzlich betrachten: Ich will meine Freiheit gar nicht, der Staat soll das für mich regeln.
Darin besteht aber auch seine zivilisatorische Leistung: das Faustrecht des Stärkeren zu beschränken.
Rostalski: Ich finde es dennoch vernünftig, skeptisch und zögerlich zu bleiben und die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit immer aufs Neue auszutarieren. Ich bin keine Anarchistin, die dem Staat die Legitimität abspricht, ich will nur innerhalb des Rahmens des freiheitlichen Rechtsstaates die Frage stellen, ob die Verschiebung in Richtung Sicherheit, die gerade stattfindet, gut und von allgemeinem Interesse ist.
Man lernt nicht mehr, sich zu wehren, sondern sich zu beschweren. Rostalski: und nach Hilfe zu rufen.
Nun tendieren sowohl Vulnerabilität als auch ihr Gegenteil, Resilienz, zur Selbstverstärkung.
Rostalski: Genau das ist das Problem: Verletzlichkeit ist nichts Objektives, und das kann man sehr gut am Sexualstrafrecht sehen. Es gibt da sehr gute und richtige Änderungen wie die "Nein heißt Nein"-Regelung oder das Verbot, jemanden sexuell zu belästigen. Das bedeutet, dass Verhalten, das bis dahin als "unerheblich" galt, nun bestraft wird. Es wurde also eine Grenze verschoben. Damit hat es aus der Sicht einer vulnerablen Gesellschaft aber nicht sein Bewenden, sondern sofort wird ein neues Risiko ausgemacht, das im Furor des Regulierens nun auch noch bekämpft werden muss.
Der Philosoph Odo Marquard hat das als die "Penetranz der negativen Reste" bezeichnet. Die Beseitigung eines Unrechts wird nicht als Fortschritt verbucht, sondern steigert die Sensibilität für geringfügigere Verletzungen: Stichwort "Mikroaggression".
Rostalski: Ja, das suchende Auge findet immer ein Risiko, dem es sich unzufrieden widmen kann. Hier müsste sich die Gesellschaft aber auch einmal darauf einigen, dass jetzt der Punkt erreicht wurde, an dem man die Dinge auf sich beruhen lassen sollte. Ich finde das sogenannte Catcalling, also Frauen hinterherzupfeifen oder anzügliche Dinge nachzurufen, natürlich auch nicht in Ordnung, aber ich denke, dass Eigenverantwortung auch für die Gemeinschaft wichtig ist und nicht alles vom Recht geregelt werden soll. Bereits 2021 hat der Deutsche Juristinnenbund die Einführung eines Straftatbestandes für bestimmte Fälle des Catcallings gefordert, und aktuell gibt es den Vorschlag für einen neuen Straftatbestand seitens der Bundestagsfraktion der SPD.
Ein besonderer Fall, auf den Sie in Ihrem Buch eingehen, ist die sogenannte "Diskursvulnerabilität", bei der schon das Sprechen über unliebsame Dinge als Übergriff erlebt wird.
Rostalski: Das wirklich Schlimme daran ist, dass wir unsere gesellschaftlichen Debatten nicht mehr so führen können, wie wir sie führen müssten, um gute Ergebnisse zu erzielen. Die Idee der Demokratie ist ja, dass wir so lange miteinander sprechen, bis alle relevanten Gründe gehört worden sind und man sich anschließend auf die Suche nach einer guten Lösung begeben kann. Wenn wir aber bestimmte Sprecher gar nicht erst auftreten lassen und deren Argumente nicht hören, weil sie als verletzend gelten, dann führt das zur Verzerrung des Ergebnisses. Das betrifft keineswegs nur irgendwelche woken Themen, sondern die großen gesellschaftlichen Debatten -ob es nun die Pandemie, der Ukraine-Krieg oder der Angriff auf Gaza ist -, bei denen wir nur noch übereinander, aber nicht mehr miteinander reden.
Als Epizentrum der Diskursvulnerabilität gilt der Universitätscampus. Wie erleben Sie das als Akademikerin?
Rostalski: Ich unterrichte ja an der Universität Köln, und hier hat der Rektor vor einigen Monaten Nancy Fraser die Albertus-Magnus-Professur für ihr Werk aberkannt, weil Fraser einen öffentlichen Brief unterschrieben hatte, dessen Unterzeichner sich für die Beendigung des Gaza-Kriegs und den Boykott bestimmter israelischer Einrichtungen aussprachen. Ich selbst hätte einen solchen Brief nie unterschrieben und finde die politische Aussage nicht richtig, aber mit Frasers Arbeiten zur Kritischen Theorie hat das überhaupt nichts zu tun. Aus meiner Sicht ist der Entzug der Professur überhaupt nicht gerechtfertigt. Der richtige Weg wäre gewesen, mit Fraser in Köln über diesen Brief zu diskutieren.
Wie sieht es bei den Studierenden aus?
Rostalski: Im Fach Jura sind sie sehr resilient, und wir streiten sehr offen. Das ist vermutlich aber auch fächerspezifisch und kann an der philosophischen Fakultät noch einmal ganz anders aussehen. Während die Philosophen immer die Probleme suchen, suchen wir Juristen ja nach Lösungen.
Ob sich die Philosophen das gefallen lassen? Rostalski: Ich bin selbst halbe Philosophin, ich glaube, ich darf mir ein solches Urteil anmaßen. Der Stellenwert des freien Meinungsaustauschs wird unter Juristen jedenfalls besonders hochgehalten, und es hat mich auch noch niemand aus dem Hörsaal zu vertreiben versucht.
Gendergerechte Sprache ist ein Dauerbrenner an der Uni. Wie halten Sie's denn damit? Mir ist aufgefallen, dass Sie in Ihrem Buch manchmal von "Studierenden" schreiben und manchmal von "Studenten". Rostalski: Ehrlich? Das ist ein Versehen. Eigentlich benutze ich immer das generische Maskulinum.
Warum? Rostalski: Weil es für Frauen, Männer und andere steht. Das grammatische Geschlecht spiegelt nicht das biologische oder soziale wider.
Das Paradox der Diskursvulnerabilität, das Sie in Ihrem Buch aufzeigen, besteht darin, dass diese nicht zu einem sensibleren Umgang miteinander führt, sondern zur Verrohung. Warum?
Rostalski: Wir leben in einer Zeit, in der Menschen dazu neigen, ihren eigenen Standpunkt moralisch so stark aufzuladen, dass sie ihn als Teil ihrer Persönlichkeit auffassen. Wenn jemand anderer Meinung ist, sehen sie das als Angriff auf die eigene Person und reagieren entsprechend mit einem Gegenangriff ad personam.
Auch die Identitätspolitik delegitimiert Sachargumente, sobald jemand über die "falsche" Identität verfügt und daher gar nicht diskursberechtigt ist. Rostalski: Ganz genau. Wir haben in Deutschland gerade die Diskussion um die Abschaffung des Paragrafen 218, der den Schwangerschaftsabbruch prinzipiell unter Strafe stellt und nur unter ganz bestimmten Bedingungen erlaubt. Ich bekomme dazu ganz viele Anfragen, die ich nicht alle annehmen kann, weswegen ich dann manchmal den Herrn Soundso empfehle; worauf ich immer zu hören kriege: "Wir können doch keinen Mann dazu fragen!" Abgesehen einmal davon, dass Schwangerschaftsabbrüche ja auch Männer betreffen -man könnte sie also sogar aus identitätspolitischen Motiven mit einbinden -, bestand die zivilisatorische Leistung der Aufklärung doch genau darin, uns von Argumenten affizieren zu lassen und die Identität des Sprechers dabei auszublenden.
Nimmt die Bereitschaft, sich zu umstrittenen Themen zu äußern, ab?
Rostalski: Eine Allensbach-Studie hat ergeben, dass 48 Prozent der Deutschen der Auffassung sind, ihre Meinung nicht mehr offen äußern zu können, weil sie Sanktionen befürchten. Da steckt aber gar nicht der Staat dahinter, sondern die Menschen haben Angst vor den Sanktionen ihrer Mitmenschen bis hin zum eigenen Freundeskreis.
Der Literaturwissenschaftler Adrian Daub, Verfasser des Buches "Cancel Culture Transfer", würde dem entgegenhalten, dass das aufgebauscht wird.
Rostalski: Daubs Position ist ausgesprochen parteiisch. Wenn man eine Person "cancelt", die eine Machtposition einnimmt, produziert das automatisch sogenannte chilling effects: Menschen, die das beobachten, aber weit weniger arriviert sind, beginnen, sich selbst zu zensieren, und greifen bestimmte Themen gar nicht erst auf. Das hätte empirisch untersucht werden müssen. Aber wie Daub zu sagen, die Zeitungen bauschen das auf und deswegen gibt es keine Cancel-Culture, ist methodisch äußerst fragwürdig.
Dem Canceln des anderen korrespondiert der Anspruch auf umfassende Selbstdefinition -etwa in Bezug auf das eigene Geschlecht. Was ist, wenn ich mich als Giraffe fühle? Rostalski: Da bin ich sehr tolerant. Wenn Sie gerne eine Giraffe sein wollen, hätte ich nichts dagegen
Ich würde natürlich von aller Welt mit einem Giraffen-Pronomen adressiert werden wollen!
Rostalski: Das Problem tritt tatsächlich in dem Moment auf, in dem Regulierungsansprüche gestellt werden und andere Sie nicht mehr "Herr Nüchtern" nennen dürfen. Diese Rechtslage existiert in Deutschland bereits: Das sogenannte Deadnaming ist sanktionsbewehrt, das heißt, wenn Sie Ihr Nachbar mit Ihrem "toten Namen" anspricht, obwohl er weiß, dass Sie jetzt ein anderes Geschlecht haben, dann können Sie ihn anzeigen, und er bekommt die entsprechende Geldbuße aufgebrummt. Ich halte das für eine problematische Form von Überregulierung in einem rein ethischen Bereich, in dem das Strafrecht nichts verloren hat.
Sie zitieren den Fall, in dem eine Transperson die Deutsche Bahn verklagt und auch recht bekommen hat, weil diese nur die Optionen "Mann" und "Frau" angeboten hatte. Rostalski: Wobei das für die Beförderungsleistung der Bahn tatsächlich unerheblich ist und man eher nach dem Gewicht als nach dem Geschlecht fragen müsste. Aber da ginge es dann erst richtig los.
In Ihrem Buch zeigen Sie Verständnis für die Reaktionen der Maßnahmenkritiker während der Pandemie.
Rostalski: Die Ablehnung der Impfung war der Höhepunkt einer ganzen Kette von Freiheitseingriffen, weswegen viele Menschen schon so wund waren. Außerdem stellt eine Impfung einen ganz erheblichen Eingriff in die eigene körperliche Integrität dar, was sogar das Bundesverfassungsgericht bestätigt hat. Hinzu kam die unzureichende Kommunikation. Die Behauptung des Gesundheitsministers Karl Lauterbach im Sommer 2021, dass ein nebenwirkungsfreier Impfstoff zur Verfügung stehe, war einfach unseriös.
Sie schreiben in diesem Zusammenhang von "additiven Grundrechtseingriffen". Was meinen Sie damit?
Rostalski: Die funktionieren ein bisschen wie die bekannte Salamitaktik: Es wird immer noch eine Scheibe weggeschnitten. Das Problem ist, dass wir immer nur eine konkrete Maßnahme diskutieren -etwa die Bestrafung des Hinterherpfeifens und dergleichen. Da wäre es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass wir soeben erst die sexuelle Belästigung normiert haben. Selbst wenn sich ein Gesetz legitimieren lässt, muss man auch sehen, dass es vielleicht doch der Tropfen ist, der den Stein höhlt.
Sie üben Kritik an Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey, die in ihrem Buch "Gekränkte Freiheit" die Motive der Maßnahmengegner analysieren.
Rostalski: Der Begriff des "libertären Autoritären", den die beiden verwenden, ist ein offener Widerspruch, und sie wissen das ja auch. Liberalismus hat eindeutig eine antiautoritäre Stoßrichtung, und dennoch unterstellen Amlinger und Nachtwey diesen Leuten, sie wären autoritär. Außerdem war der Kreis jener, die gegen die Corona-Maßnahmen protestiert haben, höchst heterogen. Man kann Mütter, die nur wollen, dass die Kinder wieder in die Kita oder die Schule gehen können, oder Menschen, die ihre Eltern im Altersheim besuchen wollen, doch nicht einfach in die Schublade des "libertären Autoritarismus" stecken!
Waren die Medien in ihrer Corona-Berichterstattung zu parteiisch?
Rostalski: Es gab Ausnahmen wie Die Welt oder die Berliner Zeitung, aber insgesamt haben die Leitmedien sehr einseitig berichtet und gegenüber der Regierungspolitik kaum bis keine Kritik walten lassen. Auch der Ruf nach einer parlamentarischen Aufarbeitung erklingt allenfalls am Rande des Medienspektrums. Dabei hätte auch die Presse eine kritische Aufarbeitung ihrer eigenen Rolle während der Pandemie bitter nötig.
Es geht nicht nur um die Frage "Mehr Sicherheit oder Freiheit?", sondern auch um den Freiheitsbegriff selbst. Sie vertreten da einen anderen als Amlinger und Nachtwey?
Rostalski: Die beiden werben für einen Begriff der sozialen Freiheit, der sich auf Solidarität beruft. Ich finde das heikel. Als Vertreterin eines liberalen Freiheitsbegriffs würde ich zunächst einmal die existierenden Freiheiten benennen und dann eine gesellschaftliche Debatte in Gang setzen: Welche Freiheiten sind wichtiger, welche weniger bedeutsam? Und dieser Ausverhandlungsprozess darf nicht dadurch abgekürzt werden, dass man Solidarität einfordert und selbst definiert, was darunter zu verstehen ist.
Was uns zur Klima-Debatte führt: Das Argument "There is no alternative" von Margaret Thatcher ist jetzt bei linken Öko-Aktivisten gelandet, die am liebsten eine Expertokratie errichten würden.
Rostalski: In der Tat: ein sehr fragwürdiges Demokratieverständnis. Für die Letzte Generationr8 wäre selbst der Gesellschaftsrat, den sie vorschlagen, nur ein ausführendes Organ der Experten. Ich erinnere mich noch, wie es in der Pandemie auf einmal hieß: "Ja, in China geht das alles viel schneller, die haben eine erfolgreichere Corona-Politik." Schlussendlich hat sich aber gezeigt, dass gerade die Staaten, die sehr liberal vorgegangen sind, geringere Mortalitätsraten aufwiesen. Wir müssen auch in der Klimadebatte einen ruhigeren Ton finden und Maßnahmen aushandeln.