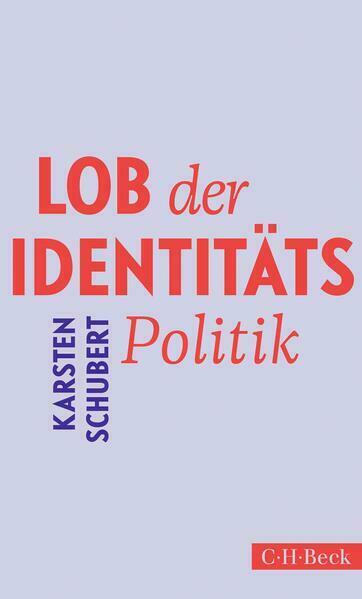Doch, wir brauchen Identitätspolitik!
Robert Misik in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 35)
Die „Identitätspolitik“ hat heute einen schlechten Ruf, man möchte beinahe meinen, sie kommt nur mehr als Injurie vor. „Woke“ ist zu einem regelrechten Schimpfwort geworden, und nicht nur Konservative reagieren hysterisch, wenn benachteiligte Bevölkerungsgruppen Forderungen stellen. Auch Weltverbesserer mit „universalistischem“ Anspruch beklagen, mit der Identitätspolitik würde ein Tribalismus einziehen, also eine Art neues Stammesdenken; gemäßigte Linke sehen die Freiheit und den vernünftigen Diskurs bedroht, wenn nicht mehr zählt, ob ein Argument plausibel ist, sondern allein, wer es vorbringt. Identitätspolitik führt, so die Klage, zu Spaltungen und einem Gegeneinander, wo eigentlich Bündnisse angesagt wären. Etwas wohlwollendere Einwände lauten, dass die Identitätspolitik benachteiligter Gruppen viel zu leicht in Übertreibungen eskaliert, sodass Theorien, die Richtiges zur Sprache bringen, ins Konfrontative oder Verrückte ausarten.
Schon der Titel von Karsten Schuberts „Lob der Identitätspolitik“ ist angesichts dieses verbreiteten Raunens eine kalkulierte Irritation. Der Berliner Theoretiker schreibt aber nicht mit pamphletistischer Verve, sondern im ruhigen Ton der politischen Philosophie. Er versucht mit durchdachten Begründungen gegen die Kritiker der Identitätspolitik zu argumentieren – und bisweilen gegen die überspannten Wirrköpfe unter deren Anhängern.
Über weite Strecken gelingt Schubert das auf plausible Weise. Identitätspolitik sei, aus seiner Sicht, die „politische Praxis marginalisierter Gruppen, die sich in Bezug auf eine kollektive Identität gegen ihre Benachteiligung durch Strukturen, Kulturen und Normen der Mehrheitsgesellschaft wehren“. Sei das der Feminismus, der gegen die Benachteiligung von Frauen aufsteht, oder der Antirassismus; seien das Bewegungen gegen Sexismus oder Herabsetzung aufgrund von sexueller Orientierung, Religion, Hautfarbe, seien es postkoloniale Diskriminierungen, was auch immer. Gemeinsam ist all diesen Bewegungen, dass sie Lebenserfahrungen und ein Leiden durch Sozialisation zur Sprache bringen, die zunächst in den dominanten Diskursen gar nicht vorkommen (oder nicht vorkamen).
Schuberts Grundthese: Identitätspolitik reagiert auf „real existierende Diskriminierungsstrukturen“. Daher sei sie nicht „antidemokratisch“, sondern im Gegenteil für „die Demokratisierung der Demokratie nötig“, da die „real existierenden demokratischen Institutionen ihren eigenen Maßstäben nicht gerecht werden“.
Die Gegner von Identitätspolitik mögen da und dort schon richtigerweise auf Übertreibungen von einzelnen Engagierten hinweisen, letztendlich steht ihre Prämisse freilich auf tönernen Füßen: nämlich, dass Diskriminierung kein fundamentales Problem unserer Gesellschaft sei, dass die Machtungleichgewichte zwischen jenen, die stets zu Wort kommen, und jenen, die (vergleichsweise) ungehört bleiben, nicht dramatisch ins Gewicht fallen. Das ist natürlich Unfug. „Weil Diskriminierungen unsere Gesellschaft strukturieren, ist Identitätspolitik notwendig.“
Identitätspolitik setzt auch nicht einfach auf vorhandene Identitäten, sondern stellt diese erst her, indem Anliegen benachteiligter Gruppen artikuliert werden – die „Identität“ wird somit verändert. Der Gegensatz zwischen Universalismus und Identitätspolitik sei, so Schubert, eine Fantasie. Man denke an die „universalen“ Werte von Gleichheit und Freiheit. Identitätspolitik ist notwendig, um ihnen erst zum Durchbruch zu verhelfen.
Problematisch wird das für Schubert nur, wenn es Gruppen in einer fixen Identität quasi einkesselt, wenn die analysierte „Vermachtung“ von Institutionen und Diskursen dazu führt, dass das argumentierende Gespräch abgelehnt wird, wenn Identitätspolitik „anti-aufklärerisch“ wird. Objektivität gibt es laut ihm nicht, weil jede Position durch die Perspektive und Erfahrung der Protagonisten geprägt sei. Das Streben nach einer „besseren Version von Objektivität“ dürfe deshalb nicht aufgegeben werden. Das Ziel sei Verständigung, nicht Gegeneinander.
So triftig Schuberts Argumentation ist, so tut er Fragwürdigkeiten dann doch etwas zu sehr als Nebensachen ab. Moralische Beschämung, das Anprangern von Leuten, die manche Dinge auch nur eine Spur anders sehen, sektiererische Rigidität, nervige Überbietungswettbewerbe in radikalen Szenen und alles, was man mit dem Komplex „Cancel Culture“ verbindet – sie alle hätten sich eine weniger beschönigende Beschreibung verdient. Schubert hingegen meint, dies alles sei nötig, um den Widerstand „aktiv ignoranter Subjekte“ zu brechen und weil unsensible Individuen „externe Hilfe“ benötigen würden. Das ist schon absurd, wenn man weiß, wie leicht auch der Gutwillige an den Pranger geraten kann und dass ein sogenanntes „ignorantes Subjekt“ einfach eine Person sein kann, die in einer Frage eine andere Auffassung hat. Auch ist „externe Hilfe“ eine ziemlich euphemistische Beschreibung für die moralische Totalvernichtung, auf die Beschämungsstrategien bisweilen hinauslaufen. Damit lässt sich jeder Unfug rechtfertigen, auch jener, der letztlich zur Diskreditierung der guten Identitätspolitik führt, deren Loblied Schubert singt.