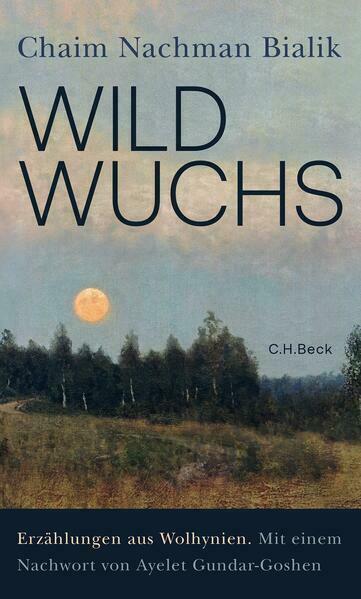In einem vergessenen Winkel Wolhyniens
Klaus Nüchtern in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 4)
Am 7. Oktober 2023, jenem Tag, an dem die Terrororganisation Hamas mit unüberbietbar zynischer Grausamkeit ein Massaker an israelischen Zivilisten verübt hat, zitiert Premier Benjamin Netanjahu in seinem Statement eine Verszeile aus einem 120 Jahre alten Gedicht. „In der Stadt des Tötens“, so dessen Titel, hat ein Pogrom zum Gegenstand, das im Jahr 1903 an der jüdischen Bevölkerung von Kischinjov begangen worden war. Die schreckliche Bilanz: 50 Ermordete, an die 500 Verletzte und 700 zerstörte Häuser.
Chișinău, heute Hauptstadt der Republik Moldau, war damals Teil des russischen Zarenreichs und das Zentrum des jüdischen Lebens. Ausgelöst hatten das Massenmorden die Leichen eines christlichen Mädchens und Buben, die in einer 40 Kilometer von Kischinjov entfernten Kleinstadt gefunden und sofort mit einem der notorisch antisemitischen Ritualmordmythen erklärt worden waren. Der zu dieser Zeit 30-jährige Chaim Nachman Bialik war von seinem damaligen Wohnort Odessa nach Kischinjov gesandt und beauftragt worden, die Folgen und Umstände des Verbrechens zu recherchieren. Wochenlang hatte er mit Vergewaltigungsopfern und Überlebenden gesprochen und schließlich besagtes Poem verfasst, neben dem sich Celans „Todesfuge“ wie Erbauungslyrik ausnimmt.
„In der Stadt des Tötens“ ist ein wütender, in seiner Drastik fast obszön anmutender Aufschrei, der seiner Leserschaft nichts ersparen will. Der Dichter nimmt diese an der Hand, um sie mit verstörender, nachgerade forensisch anmutender Beflissenheit durch die Topografie des Terrors zu geleiten: „Frage nur die webenden Spinnen“, heißt es zu Beginn des knapp zehnseitigen Gedichts, „Sie sind Zeugen, haben alles mitangesehen und lassen dich wissen, / Wie man Frauenleiber aufriss und mit Federn füllte, / Wütete mit Hammer und Rad, Gesichter beschlug mit Nägeln, / Wie man Menschen schlachtete, an Balken aufknüpfte / Den Säugling schlafend fand an der kalten Brust der erstochenen Mutter.“
Hader gegen einen Gott, der dies zuließ, findet man hier ebenso wie Verachtung für jene, die sich wie Mäuse verkrochen, anstatt sich zu wehren, und ihr Opferdasein gar zu kapitalisieren suchen: „Siehst du in Massen gebrochene Menschen stöhnend und ächzend / Vor der Reichen Fenstern lauern, die Türen belagern, / Prahlend die Wunden zeigend, als seien es Krämerwaren […]: ,Mein Vater war ein Märtyrer – mögt ihr’s uns entlohnen.‘“
Das lese sich, so merkt die israelische Schriftstellerin Ayelet Gundar-Goshen in ihrem Nachwort an, gerade so, als wären die gescholtenen jüdischen Männer „einem antisemitischen Artikel in einem deutschen Nazi-Blatt entstiegen“. Tatsächlich aber handle es sich um eine Rhetorik, die die Adressierten zur Wehrhaftigkeit und dazu ermuntern will, nicht in der Position des Opfers zu verharren.
„In der Stadt des Tötens“ lag bereits in einer deutschen Übersetzung aus dem Hebräischen vor. Alle anderen Texte Bialiks aber, die der vor kurzem erschienene Band „Wildwuchs. Erzählungen aus Wolhynien“ versammelt, sind erst jetzt ins Deutsche übertragen worden. Es handelt sich dabei um eine literarische Entdeckung, die in dem Reigen saisonaler Veröffentlichungen ihresgleichen sucht. Diese Pioniertat muss man dem C.H. Beck Verlag hoch anrechnen, ebenso wie dessen Entscheidung, die Publikation mit gleich drei Nachworten, einem Glossar und einer Karte zu den ethnopolitischen Gegebenheiten um 1900 auszustatten und zu kontextualisieren.
In Israel genießt Bialik den Status eines Nationalhelden. Als Vertreter eines Kultur-Zionismus habe er, wie es Gundar-Goshen formuliert, dem Hebräischen einen kräftigen Klaps auf den Hintern gegeben und dieses für die säkulare Literatur dienstbar gemacht. Als Bialik 1934 mit 61 Jahren an den unerwarteten Folgen einer Routineoperation in Wien verstarb, wurde sein Leichnam nach Tel Aviv überstellt und mit großem zeremoniellen Aufwand bestattet: „Israel ist verwaist: Chaim Nachman Bialik ist von uns gegangen“, konnte man auf der Titelseite von Davar, dem führenden Blatt des jüdischen Palästina, lesen.
1873 in einem Dorf namens Radiwka im wolhynischen Teil des russischen Reichs (heute: Ukraine) geboren, wuchs Bialik nach dem frühen Tod seines Vaters in der Obhut des Großvaters, eines strenggläubigen Holzhändlers, auf, weil sich die Mutter außerstande sah, weiterhin für ihn und seine beiden Geschwister zu sorgen. Über Nacht de facto zum Vollwaisen geworden und darüber hinaus aus seinem Geburtsort nach Schytomyr verbracht, hat Bialik diesen Bruch sein Leben lang als Verstoßung aus dem Paradies empfunden.
Seiner frühen Kindheit erinnert er sich in der hundertseitigen, unverstellt autobiografischen Erzählung „Wildwuchs“, an der er über ein Vierteljahrhundert lang gearbeitet hat, als eines einzigen ekstatischen Sommers, auf den Enttäuschung und Ernüchterung folgen – inklusive eines Watschenhagels, den der „Meisterohrfeiger“ von Vater über seinen Buben niedergehen lässt, den er ob dessen verträumten und wenig weltgewandten Wesens verachtet: „Ich will, dass du an dieser Scheibe Brot erstickst, die du mir stiehlst, du abtrünniger Bastard“, brüllt er ihn an, „dass du ein Jude wirst, wie ich. Ein Mensch wie alle anderen.“
Zuneigung und Zärtlichkeit seitens der Eltern und Großeltern erlebt Bialik kaum. Die, wie er selbst einräumt, möglicherweise nur imaginierten Erinnerungen an goldene Kindheitstage in einem „vergessenen Winkel Wolhyniens mit verschwiegenem Schilf und Sumpfland und endlosen Wäldern“ aber scheinen eine unversiegbare Quelle einer geradezu ozeanischen Verbundenheit mit der Schöpfung zu sein.
Greifbarer noch als die von Lichtmetaphorik durchzuckte und mit Schauern von „Wie“-Vergleichen garnierte Erzählung „Wildwuchs“ evoziert „Hinter dem Zaun“ Kindheit und Jugend Bialiks. Es ist eine Art Version von „Romeo und Julia auf dem Dorfe“, die eher desillusionierend als tragisch endet und den antiken Mythos von Pyramus und Thisbe nach Wolhynien transferiert: Nicht ein Spalt in der Mauer, sondern ein Astloch im Zaun ist es, durch welches das zunächst noch kindliche, später im Saft der Spätpubertät siedende Liebespaar kommuniziert: Er, der resolute und raufselige Noah aus der Siedlung der jüdischen Mehrheit; sie, das Findelkind Marinka, das im Hof einer verbiesterten alten Goj namens Schakoripinschchika wie ein Tier gehalten und misshandelt wird.
Das Leben in der Kleinstadt, wie es Bialik beschreibt, stellt so etwas wie den Gegenentwurf zu den idyllisch-poetischen Szenen orthodoxen Lebens dar, wie sie dessen um einiges jüngerer Zeitgenosse, der Maler Marc Chagall, für das heute belarussische Witebsk ausgepinselt hat. Zwischen den aneinandergrenzenden Häusern der beiden juvenilen Protagonisten bekämpfen die äußerst fragwürdig agierenden Erziehungsberechtigten einander im Stile brutalsten Slapsticks: „Durch die Luft, von Dach zu Dach, fliegen – zum Entsetzen der Vögel droben und zum Jubel der Kutscher drunten – Hacken und Rechen, Krüge und Kanister, Nudelhölzer und Holzscheite. Schakoripinschchikas Hof füllt sich mit Hundejaulen und Kläffen und Hahnenkrähen. […] Die Jungkutscher auf der Straße rufen ,Hurra!‘ – und das ganze jüdische Viertel lebt noch tagelang in Angst und Schrecken …“
Bialik ist ein Meister der Mise en Scène, der seine Geschichten ganz in der konkreten Örtlichkeit zu verankern und aufs Üppigste auszustatten weiß; wobei Idylle und Entsetzen, Geborgenheit und Entfremdung oft Tür an Tür wohnen. „Die beschämte Trompete“, mit knapp 50 Seiten das kürzeste Stück des Bandes, ist eine aus der Distanz von drei Jahrzehnten referierte Rahmenerzählung über eine jüdische Familie, die sich leider genau einen Tag nachdem ein Ansiedlungsverbot für Juden verhängt wurde, in einem Dorf nahe einer Kleinstadt niederlässt – und sich den Schutzgeldforderungen der örtlichen Polizisten sowie den Unverschämtheiten der nicht-jüdischen Bevölkerung ausgesetzt sieht.
Wie der Vater des jugendlichen Protagonisten in die Fänge der Behörden gerät und versucht, über zwielichtige Mittelsmänner selbige günstig zu stimmen, erinnert an Kafkas „Prozess“, der legendenhafte Gestus indes eher an Joseph Roth. Es ist ein Ton, der dem Entsetzen ein wenig die Kanten abschleift, ohne deswegen an Eindringlichkeit einzubüßen. Und so kommt es, dass am Ende selbst die Trompete des großen Bruders, die dem Pessach-Fest zusätzliche Strahlkraft hätte verleihen sollen, im Futteral verbleibt und beschämt schweigt.
Apropos Sound. Bialiks Prosa ist erstaunlich disparat – oft innerhalb einer einzigen Erzählung. „Hinterm Zaun“ etwa scheut bei aller Komik auch nicht das expressionistische und – wenn das Blut aus dem Fleisch schreit und unsichtbare Glocken schwer und rötlich hallen – einigermaßen übersteuerte Pathos nicht.
Gelegentliche Stilbrüche dürften freilich auch aufs Konto der Übersetzung von Ruth Achlama gehen. Ein flapsiges „Bist du irre?“ kontrastiert mit einem gestelzten „Hohl ihn mir aus der Sicht!“; ein gejubeltes „Hach!“ passt in Erika Fuchs’ Entenhausen, aber nicht in ein wolhynisches Dorf des Fin de Siècle. Und was ein Satz wie der folgende überhaupt besagen will, bleibt unklar: „Zuerst zieht es mich auch zu einer dieser Gruppen und ihren Aktivitäten, aber fixgeschwind, ehe ich noch weiß, wie mir geschieht, bin ich außen vor …“. Dergleichen Irritationen ändern freilich nichts daran, dass „Wildwuchs“ eine, wenn nicht die literarische Entdeckung der Saison ist.