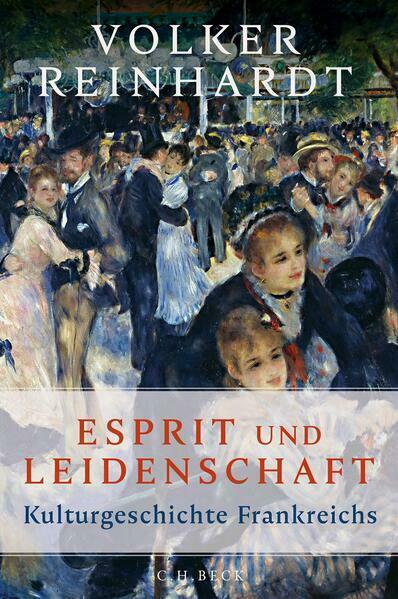Süßes Frankreich!
Thomas Leitner in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 34)
Kaum jemand scheint so berufen, eine Kulturgeschichte Frankreichs zu schreiben, wie Volker Reinhardt, emeritierter Professor der Geschichte der Neuzeit in Fribourg, hat er doch zahlreiche Monografien über Geistesgrößen wie Leonardo da Vinci, Montaigne, Voltaire und „den schrecklichen Marquis“ de Sade verfasst. Auch seine anderen Spezialgebiete stehen in dynamischer Interaktion mit dem neuen Band: Viele Anknüpfungspunkte finden sich zu „Pontifex“, der Geschichte der Päpste, und vor allem zur Kulturgeschichte Italiens („Die Macht der Schönheit“).
Die kulturelle Vielfalt Italiens mit den zahlreichen lokalen Zentren lädt zu stereotyper Einebnung erst gar nicht ein – die etwas homogenere Entwicklung Frankreichs jedoch förderte die Tendenz, ein Idealbild von sich selbst zu entwickeln. Von außen antwortete man darauf mit (negativen) Stereotypisierungen wie der von der „Grande Nation“ für die angebliche Überheblichkeit. Das mit feiner methodischer Klinge argumentierende Vorwort stellt klar, dass Reinhardt allen Klischees entgehen will und sich jeder Vorstellung von „Volksgeist“ und „Nationalcharakter“ verweigert.
Eine bloße Aneinanderreihung von künstlerischen Großtaten und intellektuellen Leistungen würde dem theoretischen Anspruch des Autors (und der Erwartung seiner Leser) ebenso wenig genügen. So sieht er seine Aufgabe in der „Herausarbeitung von Leitmotiven“, um „einen Prozess der kreativen Erfindung“ zu beschreiben, „in der Intellektuelle und Künstler […] ihre Ideen und Werke als Beitrag zu einer gemeinsamen Kultur […] konstruieren“.
In 68 Miniaturen versteht es Reinhardt, Momente und Orte der Erinnerung des französischen Kollektivgedächtnisses lebendig darzustellen. Den Ausgangspunkt nimmt er mit den Klagen der Ritter des Rolandslieds (um das Jahr 1100), die mit „dulce France“ ihrer Sehnsucht nach der „süßen Heimat“ Ausdruck verleihen. Er spannt einen weiten Bogen bis in die unmittelbare Vergangenheit und trifft im letzten Kapitel auf François Mitterrand, Präsident zwischen 1981 und 1995, der mit monumentalen Projekten – etwa der Glaspyramide vor dem Louvre und dem gigantischen Triumphbogen Grande Arche („Großer Bogen“) – versucht, die nationale Glorie aufzupolieren. (Reinhardts Rede von der „Grande Nation“ als ironischem Kommentar zum präsidentiellen Ehrgeiz ist ein Widerspruch zu seiner sonstigen Distanz zum Klischee.)
Seine thematischen Verbindungslinien sind mutig und originell. Da wird vom akademischen Selbstbewusstsein der Pariser Sorbonne des Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert eine Kontinuität hin zur studentischen Revolte von 1968 gedacht. An anderer Stelle erscheint die Häretikerbewegung der Katharer mit ihren pazifistischen und antiautoritären Zügen als Ausgangspunkt einer Traditionspflege, die als „etwas Bodenständiges und Aufmüpfiges zugleich“ bis zu den Bauernprotesten reicht.
In seinem weiten Kulturbegriff behandelt Reinhardt auch Populäres wie das Chanson oder Comics. Zu „Asterix bei den Olympischen Spielen“ fällt ihm eine besonders raffinierte Assoziation auf: Er verbindet die Ankündigung des Stadionsprechers, die Athleten der griechischen Insel Kythera seien am Festland angekommen, mit dem enigmatischen Titel des Bildes von Antoine Watteau: „Die Ausschiffung von Kythera“. Darauf kommt nur ein intimer Kenner.
Reichlich Lesevergnügen also. Freilich hätte „Esprit und Leidenschaft“ noch umfangreicher ausfallen können. Neben den abgehandelten Hochleistungen des Strukturalismus würde ein Kapitel zur Philosophie mit Michel Foucault und Gilles Deleuze Paris in den 1970ern als intellektuelle Welthauptstadt zeigen. Neben der Tour de France wünschte man sich auch den Esprit des französischen Fußballs erwähnt, ebenso hätte sich die Statue der „Marianne“ mit wechselnden Gesichtern französischer Stars einen Platz verdient. In einer erweiterten Neuauflage vielleicht?