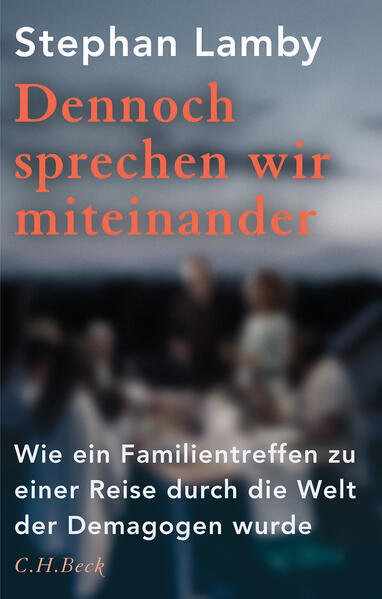Familientreffen mit Faschisten
Georg Renöckl in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 30)
Zuschauern und Lesern Einblicke in Situationen und Gedankenwelten zu vermitteln, die ihnen sonst verschlossen sind“, das ist Stephan Lambys Job. Doch plötzlich versteht der vielfach preisgekrönte deutsche Dokumentarfilmer die Welt nicht mehr: Bei einer Familienfeier erfährt er, dass sein in den USA lebender Cousin Martin Teil des Mobs war, der im Jänner 2021 das Kapitol gestürmt hat. Dabei ist Martin ein hilfsbereiter, charmanter, humorvoller und dialogfähiger Mensch – und bis heute überzeugt davon, damals die Demokratie verteidigt zu haben. Wie konnte er auf einen solchen Irrweg geraten? Und wie konnte dieser Mob überhaupt entstehen? Der routinierte Erklärer ist ratlos. „Seit beinahe 40 Jahren beobachte ich politische Prozesse. Noch nie habe ich die Wut auf das herrschende System, die Sehnsucht nach Umsturz und ja, nach Zerstörung als so tiefgreifend und bedrohlich empfunden wie in den letzten Monaten“, so Lamby. „Was ist los in unserem Land? Was ist los in anderen Ländern?“
Der Autor beschließt, seinen Fragen auf einer langen Reise nachzugehen. In den USA, Argentinien, Ostdeutschland und Norditalien macht er sich auf die Suche nach den Gründen für die zunehmende Bereitschaft zur Zerstörung der Demokratie und den Aufstieg zweifelhafter Figuren, die als vorgebliche Außenseiter im politischen Betrieb reüssieren. Die Rede ist von Donald Trump, Javier Milei, Björn Höcke und den italienischen Post- und Neofaschisten.
Im Süden der USA glitzert das Erbe der von Trump inbrünstig beschworenen Nachkriegszeit, in der Amerika allmächtig schien, nur noch aus der Distanz verführerisch. In Memphis, Tennessee, spürt Lamby der Erinnerung an Elvis Presley nach – ein Idol Donald Trumps, der mit dem „King“ sowohl die Vorliebe für Waffen, Autos und goldene Wasserhähne als auch den Narzissmus gemeinsam hat. Der Autor spricht im tiefsten Süden der USA mit evangelikalen Predigern und schwarzen Immobilienunternehmern, die ihm von Trumps nostalgischer Vision eines von Weißen dominierten Westens erzählen. Diese wirkt angesichts der sich verändernden ethnischen Zusammensetzung der US-Bevölkerung zwar realitätsfern, erklärt Trumps schrille Rhetorik in Sachen Abtreibung und Migration aber doch ein Stück weit. Mit vielen weiteren Fragen im Gepäck reist Lamby nach Argentinien weiter, das Land Javier Mileis.
Zu den ersten Maßnahmen des deklarierten Staatsfeindes, den sich das von korrupten Politikern ruinierte Land zum Präsidenten gewählt hat, zählen die Schließung der staatlichen argentinischen Nachrichtenagentur und die Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Von einem der letzten kritischen Journalisten Argentiniens erfährt Lamby Befremdliches über das Privatleben Mileis, der die Gesellschaft von Hunden derjenigen von Menschen vorzieht. In einem Interview behauptete er allen Ernstes, sein mittlerweile geklonter Hund und er seien sich in einem früheren Leben schon einmal als Gladiator und Löwe im römischen Kolosseum begegnet. Für Argentinier klinge das laut Lamby nicht so verrückt wie für uns, da es in diesem Land ein traditionell starkes Bedürfnis nach Überfiguren gebe – man denke an Diego Maradona, Evita oder Lionel Messi. „Insofern empfinden es viele Menschen auch nicht als befremdlich oder gar anstößig, dass ein Außenseiter behauptet, gemeinsam mit seinem Hund von Gott gesandt worden zu sein, um sein Volk aus der Misere zu führen. Viele Argentinier wollen in ihm tatsächlich den Auserwählten sehen.“
Wie diskutiert man mit Menschen, die derartige Ansichten vertreten? Immer wieder zitiert Lamby aus den Gesprächen, die er etwa mit argentinischen Journalisten, Wirtschaftswissenschaftlern oder Bankern führt, mit italienischen Mussolini-Nostalgikern oder mit dem Anwalt des AfD-Politikers Björn Höcke. Zuhören zu können heißt dabei natürlich nicht, auf Widerspruch zu verzichten. Was Stephan Lambys Kunst der Gesprächsführung ausmacht, ist vielmehr ein ständiges Hinterfragen eigener Gewissheiten („Bin ich zu skeptisch?“), regelmäßiges Innehalten für Nachdenkpausen sowie das ernsthafte Bemühen, auch auf abenteuerliche Gegenargumente einzugehen. Dadurch bringt er seine Gesprächspartner dazu, mehr zu liefern als bloße Floskeln, die Debatten in das sonst oft übliche Hickhack und das Austauschen von Stehsätzen abgleiten lassen. Freilich kommt auch Lamby gelegentlich an den Punkt, an dem sich Gegensätze nicht mehr überbrücken lassen. „Unser Gespräch stößt an eine Grenze, ich stoße an eine Grenze“, heißt es da.
Durch das beharrliche Ausloten dieser Grenzen nimmt Lamby von seiner Reise durch die Welt der Demagogen Erkenntnisse mit nachhause, aus denen er einen eindringlichen Befund der globalen Demokratiekrise ableitet. Die in Wut umschlagende diffuse Angst vor dem Bedeutungsverlust, die in schrumpfenden Gesellschaften oft herrscht, hat er genauso erlebt wie die tiefe Vertrauenskrise in die Politik, die verantwortungslose Politiker ausgelöst haben. Demagogen verstehen diese Krise für sich zu nutzen. Sie vermitteln mit der Politik unzufriedenen Menschen wie Lambys Cousin Martin ein Gefühl von Zugehörigkeit und Anerkennung, das ihre Anhänger dazu bringt, ihre schleichende Radikalisierung mitzumachen.
Lamby gibt sich dennoch nicht hoffnungslos. Gesellschaft sei kein Zustand, sondern ein Prozess, auf den man Einfluss nehmen könne. Wie auf die Großfamilie, die ihn auf die Idee zur Reportage gebracht hat: „Man muss nicht bei allen Themen übereinstimmen, aber man kann lernen, die Verwandten auszuhalten, möglicherweise sogar zu