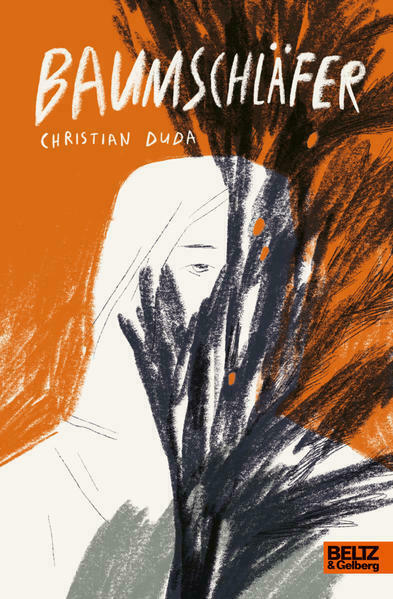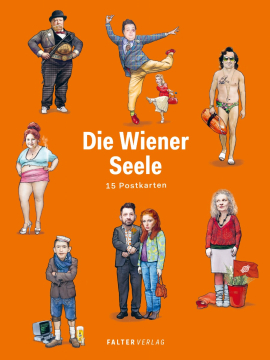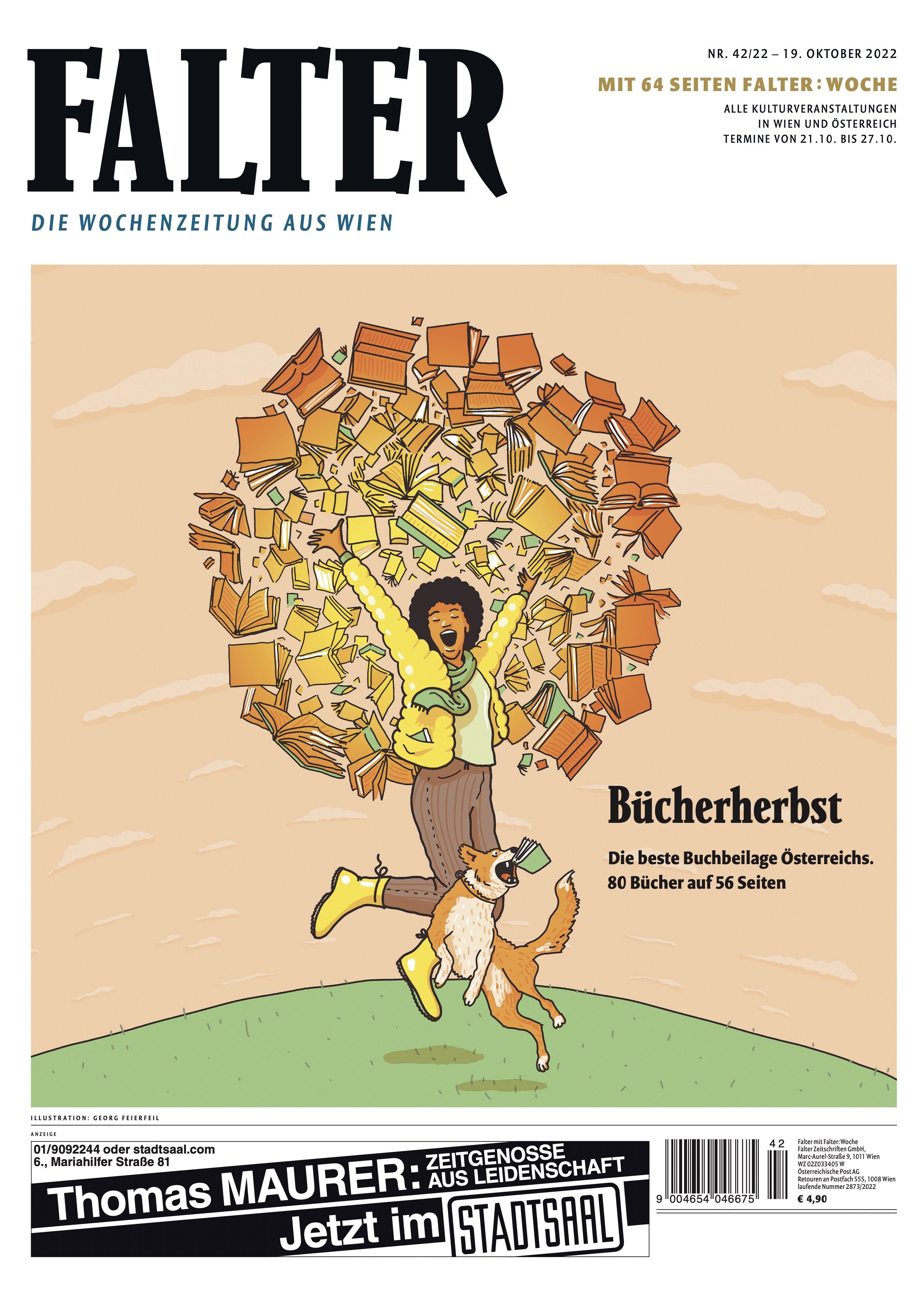
Glaub kein Wort, denn alle lügen
Kirstin Breitenfellner in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 30)
Die Geschichte ging 2017 durch die Medien. „Mark“ – der Name ist vermutlich ein Pseudonym – hatte seine Mutter durch einen Angriff des Vaters mit dem Messer verloren, bei dem auch der Junge verletzt wurde. Mark und seine Schwester landeten in betreuten Wohngemeinschaften, dort hielt es Mark aber nicht aus, lebte auf der Straße, bis er zwei Jahre später tot auf einem Baum entdeckt wurde.
Christian Duda hat Marks kurzem und hartem Leben mit dem Roman „Baumschläfer“ ein Denkmal gesetzt. Er erzählt die Geschichte nicht nur nach, sondern lässt den anfangs 14-Jährigen als Kommentator auftreten. In fett gedruckter Schrift notiert er dessen Gedanken. Dieser Metatext verleiht dem nicht sehr gesprächigen Buben eine authentische Stimme, die unter die Haut geht.
Die vier Kapitel des Romans, „Anklage“, „Urteil“, „Vollzug“ und „Kommentare“, sind in Unterpunkte aufgegliedert, die akademische Arbeiten nachahmen: 1.1, 1.2, 1.2.1 etc. Mit dieser Distanznahme teilt Duda den Schicksalsbrocken, mit dem Mark umzugehen hat, in wenn auch nicht verdaubare, so doch konsumierbare Häppchen.
Christian Duda wurde 1962 unter dem Namen Ahmet Ibrahim el Said Gad Elkarim in Graz geboren, er arbeitete an deutschen Theatern und lebt heute in Berlin. Seine Kinderbücher, die Außenseitertum, Alkoholismus, Analphabetismus, Armut oder Adipositas thematisieren, wurden mit zahlreichen Preisen bedacht. „Baumschläfer“ ist sein erster Jugendroman. Was heißt Jugendroman! Der Autor erschafft mit seinen einfachen, klaren, hammerharten Sätzen nichts weniger als ein Stück Literatur von großer Wucht und Klarheit, das sich nicht, wie in dem Genre gängig, an den Jargon der Jugend anzubiedern versucht.
Der Roman beginnt mit dem 24. Januar 2014. Marius – so heißt „Mark“ hier –, selbst verletzt, stürzt in das Büro, das gegenüber der elterlichen Wohnung liegt. Der Praktikant dort, Fabian, der die Szene später den Medien schildern wird, ist komplett überfordert. Marius bittet ihn um Hilfe für seine Mutter, wird selbst ins Krankenhaus eingeliefert und erfährt erst dort die ganze Wahrheit: „Sie ist ihren schweren Verletzungen erlegen.“
„Was für eine Scheißart, es zu sagen!“, kommentiert Marius’ Stimme, fett gedruckt. Der Junge kann sich nicht gut ausdrücken, besitzt aber ein feines Sensorium für Beschönigungen, Lügen und Manipulationen. Und selbst eine ganz eigene Liebe zur Sprache. Wenn er überfordert ist, lenkt er sich gerne mit Wortverdrehungen ab und versteckt sich hinter Sarkasmus.
Ein Jahr nach dem Prozess bringt sich der Vater im Gefängnis um. In der Wohngemeinschaft, in der Marius einen Freund gefunden hat, zieht er sich immer mehr zurück. Er hat ein Talent zum Comiczeichnen, aber die Betreuer kritisieren zu viel Blut in den Geschichten.
Marius beginnt die Schule zu schwänzen, wird beim Klauen erwischt. Er ist auch für die gestandensten und einfühlsamsten unter den Sozialarbeitern nicht mehr erreichbar. Der Erzähler hält zu seinem jungen Helden. „Ich beschließe, dass Marius nicht trinkt“, schreibt er an einer der wenigen Stellen, an denen er sich offen zu erkennen gibt. „Er, der seinem Vater das Trinken nicht verzeihen kann, soll nicht trinken. Ich will das nicht.“
Duda macht klar, dass an diesem Fall nicht das System versagt hat. Umso trauriger wird diese heillose Lebensgeschichte. Marius lebt unbewusst nach „Gefängnisregeln“: „Traue niemandem. Misstraue allen. Glaub kein Wort. Alle lügen.“ Er wird zu einem Sandler, mit Erfrierungen, Wunden, Entzündungen. Eine Zeit lang schläft er auf dem Vordach des Gesundheitsamtes und zuletzt auf einem Baum, wo seine Leiche erst Monate später entdeckt wird.