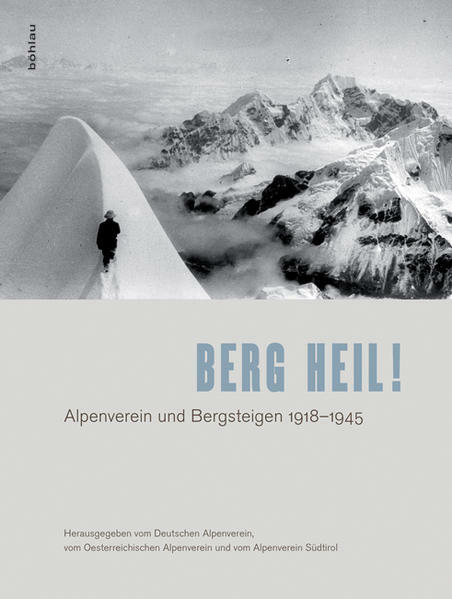"Heute hört man auf den Hütten Reggae"
Matthias Dusini in FALTER 33/2012 vom 15.08.2012 (S. 23)
Edelweiß und Gipfelkreuz sind nationale Leitbilder, die vom Oesterreichischen Alpenverein maßgeblich mitentwickelt wurden. Ein Gespräch über die Heimatfabrik OeAV, die heuer 150 Jahre alt wird
Vor 150 Jahren, im Jahr 1862, wurde der Oesterreichische Alpenverein (OeAV) gegründet. Das Wandern ist ein Motor nationaler Identitätsbildung. Die Wachstumsbranchen Bergtourismus und Alpinausrüstung sind auf die Wege und Hütten des Alpenvereins angewiesen. Der Falter nahm das Jubiläum zum Anlass, um den OeAV als Heimatfabrik zu hinterfragen. Der Zeitgeschichtler Martin Achrainer, Mitverfasser der Jubiläumspublikation "Berg Heil!", antwortete mit der stoischen Ruhe eines mit den Schrecken des Gebirges und der Historie vertrauten Wissenschaftlers.
Falter: Die Geschichte des Oesterreichischen Alpenvereins hat auch ihre dunklen
Flecken. So waren Juden auf den Schutzhütten nicht erwünscht. Wie genau ist es um den Antisemitismus des OeAV bestellt?
Martin Achrainer: Der war vor dem Ersten Weltkrieg eher die Ausnahme. Da hat es nur eine Handvoll Sektionen gegeben, die keine Juden aufgenommen haben, aber auf den Hütten war das kein Thema. Der Alpenverein stand ab 1910 unter einer Gesamtleitung und die hat damals beschlossen, einen Arierparagrafen abzulehnen. Nach dem Weltkrieg haben die Antisemiten – ausgehend von Wien – großen Druck ausgeübt. Die Leitung hat es dann 1920 den Sektionen freigestellt, ihre Bestimmungen so zu formulieren, wie sie wollen, was ja auch der Realität entspricht: Die einzelnen Sektionen sind nämlich bis heute selbstständige Vereine.
Und wie haben die damals entschieden?
Achrainer: Viele Sektionen haben den Arierparagrafen eingeführt. In Wien kam es zu einer Art Frontstellung: Die Sektion Austria, die mitgliedermäßig größte, war 1921 in Wien der einzige größere alpine Verein, außer den Naturfreunden, der keinen Arierparagrafen hatte. So hat in der Sektion Austria eine antisemitische Kampagne eingesetzt. Man wollte den Verein insgesamt "arisieren". Die jüdischen Mitglieder sind ausgetreten und haben die liberale Sektion "Donauland" gegründet.
Und dann?
Achrainer: Da sind zum ersten Mal Plakate gedruckt worden, auf denen stand: "Auf dieser Hütte sind Juden und Mitglieder der Sektion Donauland unerwünscht!" Die Vereinsleitung hat sich vergeblich darum bemüht, dass diese Plakate entfernt werden. Man hat sich schließlich auf einen Kuhhandel eingelassen. Die Sektion "Donauland" wurde aus dem Alpenverein ausgeschlossen, dafür haben sich die anderen Sektionen bereit erklärt, alle antisemitischen Aktivitäten zu unterlassen. Wir kennen einen Fall in der Sektion Villach, das Dobratsch-Gipfelhaus: Da hatte der Pächter im Vertrag stehen, dass er gekündigt wird, wenn er Juden ins Haus lässt.
Lässt sich der OeAV in seiner Anfangszeit mit anderen liberalen Vereinen wie der Geographischen Gesellschaft vergleichen?
Achrainer: Der OeAV von 1862 war ein typischer bürgerlicher Bildungsverein. Man hat nicht Hütten und Wege gebaut, sondern Vorträge organisiert und publiziert. Es gab damals den Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, der wohl das Vorbild für den Österreichischen Alpenverein war. Es ging um die Beschreibung des Gebirges und um die Vermittlungen von Beobachtungen jeder Art, geologischer, botanischer, alles Mögliche.
Wann ging es los mit den Hütten
und Wegen?
Achrainer: Sehr schnell. Für die Mitglieder außerhalb Wiens war es zu wenig, einmal im Jahr ein Buch zu bekommen. Es gab offensichtlich das Bedürfnis, Gebirgsregionen leichter zugänglich zu machen. 1869 entstand in München der Deutsche Alpenverein als Opposition gegen die Zurückhaltung der Wiener Vereinsleitung in der praktischen Arbeit.
Werden auf den Schutzhütten am Abend noch immer Wehrmachtslieder gesungen?
Achrainer: Nicht mehr. Ältere Mitglieder beklagen sich, dass überhaupt nicht mehr gesungen wird. Heute trifft man dort viele junge Kletterer und hört eher Reggae als Nazi-Lieder.
Was ist ein Bergsteigeressen?
Achrainer: In der Gastronomie gibt es das sogenannte Jugendgetränk. Das muss billig und ohne Alkohol sein. So etwas Ähnliches ist das Bergsteigeressen, eine nahrhafte, sehr billige Speise, die jedem Alpenvereinsmitglied zusteht. Es wurde in den 1920er-Jahren mit festem Gewicht und Nährwert eingeführt. Damals wurde auch festgelegt, dass der Bergsteiger sein Essen selber kochen darf, um die Hütten wieder spartanischer zu machen. Man wollte vom Hotelbetrieb wegkommen, denn die Hütten waren heillos überfüllt. Innerhalb des Alpenvereins gab es eine starke Strömung, die gesagt hat, die Berge sind den Bergsteigern vorbehalten, nicht den Sommerfrischlern, die den ganzen Tag auf der Terrasse sitzen.
Hat man damals auch die Federbetten
durch Pferdedecken ersetzt?
Achrainer: Das ist eine lustige Anekdote, die zeigt, dass der Verein von der Südgrenze Österreichs bis zur Ostsee reichte. Auf der Hauptversammlung 1925 hat man ewig lang über die Federbetten gestritten, bis jemand draufgekommen ist, dass die einen darunter eine Decke und die anderen eine Federkernmatratze verstehen. Ein anderer Streitpunkt war, ob es Zimmer geben soll oder nur Lager.
Liegen dort lauter nach Bier stinkende,
schnarchende Männer?
Achrainer: Die stinken eher nach Fußschweiß. Aber das mit dem Schnarchen stimmt.
Ist es früher sexuell freizügig zugegangen?
Achrainer: Das Leben auf den Hütten war um die Jahrhundertwende viel förmlicher und strenger als jetzt. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine Flut von Beschwerdebriefen über die Verwahrlosung der Jugend durch den Krieg – den Verlust von Förmlichkeiten, des Respekts vor den Alten. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass viele junge Männer Waffen dabei hatten und in der Gegend herumgeballert haben. Es gibt massenhaft Hütteneinbrüche und Beschwerden über den sogenannten Alpinismus sexualis, der sich wohl weniger auf den Hütten als im Freien abgespielt hat.
Gab es diesbezüglich einen Unterschied
zwischen Alpenverein und den sozialistischen Naturfreunden?
Achrainer: Die Naturfreunde haben auch FKK-Kultur geduldet, wohingegen es für die Alpenvereinler eine Katastrophe war, wenn jemand ein Sonnenbad genommen hat. Man hat sich sogar Bekleidungsvorschriften überlegt, etwa dass ein Mann nicht mit offenem Hemd in den Gastraum geht.
Was sind heute so die häufigsten
Beschwerden?
Achrainer: Wir haben hunderttausende Nächtigungen, da gibt es immer Klagen. Ich glaube, die häufigste ist immer noch die, dass die Hüttenwirte in die Suppe spucken. Im Ernst: Wahrscheinlich ist es die vorgeschriebene, aber nicht eingehaltene Nachtruhe.
Auch der Berg war in politische Lager
aufgeteilt. Wurden diese Konflikte offen ausgetragen?
Achrainer: Das Verhältnis zwischen Alpenverein und Naturfreunden ist 1923 ganz gezielt beschädigt worden. Und zwar von jenen völkischen Kreisen, die auch den Antisemitismus gefördert haben. Das Machtmittel des Alpenvereins war die Gebührenermäßigung. 1923 wurde den anderen alpinen Vereinen die Ermäßigung für Übernachtungen aufgekündigt. Getroffen hat das in erster Linie die Naturfreunde, nicht so sehr die wohlhabenden, bürgerlichen Vereine. Die Ausdifferenzierung zwischen Schwarz und Braun war hingegen eine kompliziertere Angelegenheit. Im politischen System Österreichs ist der Alpenverein eine der wenigen Organisationen, die sich der Spaltung in ein braunes und ein schwarzes Lager entzogen hat.
Wie würden Sie das bewerten?
Achrainer: Positiv daran war, dass man zumindest versucht hat, die rechtsradikalen Exzesse im Zaum zu halten, schlecht hingegen war, dass die gemäßigten Rechten in Geiselhaft genommen worden sind. Der Antisemitismus kam im Alpenverein für österreichische Verhältnisse eher spät. Die Studentenverbindungen haben sich bereits in den 1880er-Jahren deklariert, die Turner in den 1890er-Jahren, dann kamen die Radfahrer und so weiter. Im Vergleich mit Deutschland wiederum war das sehr früh. Immer wenn man über das Thema "Sektion Donauland" und Antisemitismus spricht, sagen die Deutschen: "So früh" und die Österreicher: "Was, erst 40 Jahre nach den Burschenschaften?!" Noch dazu, wenn man weiß, dass der Alpenverein ja richtig großdeutsch organisiert war.
Was hat man gesagt, wenn man sich dennoch begegnet ist?
Achrainer: Gar nichts. Man hat Abzeichen getragen. Die Leute vom Alpenverein grüßten sich, die Naturfreunde grüßten sich. Gegenseitig hat man sich nicht mehr gegrüßt.
Ab welcher Höhe duzen sich Wanderer?
Achrainer: Das Duzen geht wohl auf die Jugendbewegung des Wandervogels um 1900 zurück. In den Bergen setzte es erst in den 1920er-Jahren ein. Meiner Einschätzung nach hängt das Duzen weniger von der Höhe als von der Wegbeschaffenheit ab. Wo man nicht mehr fahren kann und das Gehenmüssen anfängt, sagt man schnell einmal "Du".
Bergsteigen hat mit rechten Tugenden wie Willenskraft und Disziplin zu tun.
Außerdem braucht es einen Führer. Darf man als Linker überhaupt ins Gebirge?
Achrainer: Dieses bewusst harte Bergsteigertum betrifft nur eine kleine Gruppe. Der Verein hat ja gerade jenen Menschen den Besuch der Berge ermöglicht, die nicht diese Fähigkeiten haben. Sie finden Wege und Hütten. Die heroische Überhöhung ist ein Produkt der 1920er-Jahre. Die Alpenvereinsfunktionäre haben nach dem Ersten Weltkrieg die Stählung von Körper und Geist durchs Bergsteigen betont, die für die "Wiederaufrichtung des deutschen Volkes" und den kommenden nächsten Krieg so wichtig sei. Was die Alpenvereinler abgelehnt haben, war das Startum, die Heraushebung des Einzelnen. Dieses Heroische ist aus der Bildsprache des Bergfilms gekommen, nicht aus den Zeitschriften des Alpenvereins.
Im vergangenen Frühjahr hat der Alpenverein in Wien eine große Veranstaltung
gemacht, in der der Extrembergsteiger Gerfried Göschl als Werbeträger vorgestellt wurde. Kurz darauf ist er auf einer vom
Verein mitfinanzierten Expedition erfroren.
Wie verträgt sich das mit dem unheroischen
Bild, das Sie zeichnen?
Achrainer: Als Historiker beziehe ich mich meistens auf die Vergangenheit. Das beste Beispiel ist die Erstbesteigung der Eiger-Nordwand 1938, die von den Medien quasi live übertragen worden ist. In den Mitteilungen des Alpenvereins gab es dazu weit hinten ein paar Zeilen. Damals hat der Verein zwar nicht die mit großen Gefahren verbundene Einzelleistung abgelehnt, er wollte sie aber nur als persönliches Erlebnis sehen, nicht als Spektakel. Das hat sich mit dem Sportklettern etwas geändert. In den 1980er-Jahren ist zum ersten Mal ein Wettbewerb akzeptiert worden. Das war vorher sogar bei den Skifahrergruppen des Vereins verpönt.
Wenn heute jemand vom Triumph des
Willens spricht, denkt er eher an
Kletterstars wie die "Huberbuam"
Alexander und Thomas als an Leni
Riefenstahl, nicht wahr?
Achrainer: Das hat mit der Hippiebewegung zu tun, die auch den Alpenverein beeinflusst hat. Das Freiklettern war im Verein verpönt. Die Kletterhippies haben auf Sicherungsmittel verzichtet und den Gipfel ignoriert – die wollten vor allem Spaß haben.
Inwiefern hängt der Erfolg des OeAV
damit zusammen, dass er mit Extremberg-
steigern wirbt?
Achrainer: Ich habe es in meinem weiteren persönlichen Umfeld immer wieder erlebt, dass jemand abstürzt und die Leute sagen: "So ein schöner Tod!" Mir ist diese Welt völlig fremd. In den Alpenvereinsmedien werden Todesfälle wie jener von Göschl jedenfalls nicht als etwas Tolles dargestellt.
Das Edelweiß und das Gipfelkreuz sind Symbole der österreichischen Nation.
Inwiefern ist der Alpenverein auch heute noch so etwas wie eine Heimatfabrik?
Achrainer: Der OeAV hat die Landschaft mitgestaltet. Almen und Gipfelkreuze gab es vorher, aber die Schutzhütte und die Wegmarkierungen sind Erfindungen des Alpinismus. Nicht immer so sichtbar, aber umso wichtiger ist die Arbeit der Mitglieder. Auch wenn sie in Wien oder Hannover wohnen, betreuen sie ein bestimmtes Gebiet in den Alpen. Das ist wie eine zweite Heimat. Die Hütte ist von der Sektion gebaut worden, die Wege müssen erhalten werden. Die Leute fahren jeden Sommer hin, verbringen dort einen Teil ihres Urlaubs. Das wird heute genauso gelebt wie vor hundert Jahren.
Was daran ist spezifisch österreichisch?
Achrainer: Der Alpenverein hat die Verbundenheit Österreichs mit dem Alpinismus nicht erfunden, aber wesentlich dazu beigetragen. In den 1980er-Jahren hat die Österreich-Werbung den Slogan "Wanderbares Österreich" geprägt. Das Wandern ist als nationale Tugend stark gepusht worden. Sogar der Nationalfeiertag ist als Wandertag propagiert worden, mit dem Bundespräsidenten voran.
Wann sind Sie das erste Mal freiwillig auf den Berg gegangen?
Achrainer: Ich bin ein Bauernbub. Wir sind weniger auf Berge, sondern mehr auf die Alm oder in den Wald gegangen.
Der Bauer schaut auf den Berg hinauf und sagt:
Achrainer: 's Wetter werd schiach!