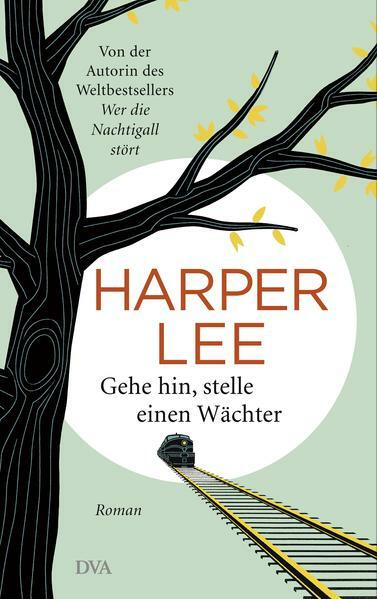Die Nachtigall bekommt einen Nachtwächter gestellt
Klaus Nüchtern in FALTER 31/2015 vom 29.07.2015 (S. 30)
Mit 58-jähriger Verspätung erscheint der Roman „Gehe hin, stelle einen Wächter“. Ist Harper Lee doch mehr als ein One-Hit-Wonder?
Ein derartiges Tamtam ist seit dem Erscheinen des letzten „Harry Potter“-Bandes um kein Buch mehr veranstaltet worden. Tonnenweise Vorbestellungen, Vorabdrucke, Vorfreude bei den Fans. Zahlreiche Buchhändler öffneten bereits in der Nacht von Montag, den 13. auf Dienstag, den 14. Juli ihre Läden, um die lange angekündigte und heiß ersehnte literarische Sensation schon ab der ersten Sekunde des offiziellen Erscheinungstermins an die lesebegierige Kundschaft auszufolgen.
Ausgerechnet in Monroeville, Alabama, aber blieb die Nachfrage nach dem Roman „Gehe hin, stelle einen Wächter“, dessen Manuskript Tonja B. Carter, die Sachwalterin der mittlerweile 89-jährigen Harper Lee, vor vier Jahren in einem Schließfach der Autorin entdeckt haben will, hinter den hochgesteckten Erwartungen zurück: „Am Dienstagvormittag schienen sich dort mehr Journalisten, freiwillige Helfer und Tourismusfunktionäre aufzuhalten als Harper-Lee-Pilger“, schrieb die Reporterin der New York Times. Eine Schlange von rund 200 Menschen hatte sich vor der einzigen Buchhandlung der 6000-Seelen-Gemeinde eingefunden, ohne die Kapazitäten des eigens beorderten Catering-Service auch nur annähernd zu erschöpfen.
Unter dem fiktiven Namen Maycomb ist Monroeville zu einem der bekanntesten Schauplätze der Weltliteratur geworden. In ihrem 1960 erschienenen Debüt „Wer die Nachtigall stört …“ („To Kill a Mockingbird“) hat Lee ihrer Geburtsstadt, wo sie heute in einem Pflegeheim lebt, ein Denkmal errichtet: „Maycomb war eine alte Stadt, und in meiner Kindheit war es eine müde alte Stadt. Bei Regenwetter verwandelten sich die Straßen in rötliche Schmutzlachen; auf den Gehsteigen wuchs Gras, und das Rathaus sackte in den Boden des Marktplatzes ein. Irgendwie war es damals heißer als heutzutage, und ein schwarzer Hund hatte an einem Sommertag viel auszustehen.“
Maycomb, das ist das bigotte, rassistische Südstaatenkaff, in dem der junge Schwarze Tom Robinson entgegen aller Evidenz für schuldig befunden wird, ein weißes Mädchen vergewaltigt zu haben. Es ist aber auch der Ort, an dem der Anwalt Atticus Finch alles in seiner Macht Stehende tut, um der bornierten Mentalität der Maycomber Moral Majority etwas entgegenzusetzen und dem Recht zu seinem Durchbruch zu verhelfen.
Sobald es um die Verteidigung seines Mandanten geht, läuft Finch zu rhetorischer Höchstform auf. Sobald der alleinerziehende Vater sich seiner pädagogischen Pflichten entsinnt – und dazu besteht reichlich Anlass – beginnen Lees Dia- beziehungsweise Monologe vernehmlich zu rascheln: „Wirklicher Mut“, so erklärt der von seinen beiden Kindern stets beim Vornamen genannte Alleinerzieher seinem Sohn Jem einmal, „heißt: von vornherein wissen, dass man geschlagen ist, und trotzdem den Kampf (…) aufnehmen und ihn durchstehen“.
In Robert Mulligans Verfilmung von 1962 verkörpert Gregory Peck den Atticus Finch, bekam für seine Darstellung einen Oscar und wurde in dieser Rolle zu einer Ikone der Rechtschaffenheit und Zivilcourage. Als bekannt wurde, dass ausgerechnet dieser Atticus Finch nun im „Wächter“ von seinem hohen moralischen Podest gestürzt, ja schlimmer noch, als sinistrer Rassist entlarvt würde, befeuerte dies die Neugier der Leserschaft und bescherte HarperCollins die meisten Vorbestellungen in der Geschichte des Verlages.
Die Aufregung, die sich seit dem Erscheinen von „Gehe hin …“ nicht mehr gelegt hat, ist also durchaus nachvollziehbar, bedarf aber einiger ergänzender Anmerkungen. Zunächst muss man wissen, dass der Roman, der seinen sperrigen Titel einem Bibelwort verdankt (Jesaja 21, Vers 6), noch vor Harpers eigentlichem Debüt geschrieben wurde, dass die Handlung allerdings 20 Jahre später spielt: Die „Nachtigall“ ist quasi das Prequel zum „Wächter“.
Angesichts dieses doch etwas verwirrenden Tatbestandes grenzt es schon an Fahrlässigkeit, dass die deutsche Ausgabe über die Editionsgeschichte kein Wort verliert und sowohl auf jeglichen Begleittext als auch auf alle Anmerkungen verzichtet, die angesichts der für Nicht-Amerikaner nahezu unverständlichen staatsrechtlichen Debatten, die Eingang in den Roman gefunden haben, schon recht hilfreich gewesen wären. Vermutlich hat die Deutsche Verlagsanstalt so viel Geld für die Übersetzungsrechte hinblättern müssen, dass für das übliche Daniel-Kehlmann- oder Felicitas-von-Lovenberg-Nachwort dann nicht mehr genug übrig geblieben ist.
Des Weiteren ist es hilfreich, sich eines Umstands zu entsinnen, der zwar als trivial gelten darf, in der Hitze des Gefechts aber gerne übersehen wird: Literarische Figuren sind keine real existierenden Personen. Spekulationen darüber, wie und warum Atticus Finch von der liberalen Lichtgestalt zum Gegner schwarzer Emanzipationsbestrebungen geworden ist, sind also müßig.
Wenn man den Atticus aus dem „Wächter“ und jenen aus der „Nachtigall“ aber schon als zwei Varianten derselben Gestalt betrachten möchte, dann hat Harper Lee ihren Protagonisten eben nicht „entlarven“ wollen, sondern sich – ganz im Gegenteil – dazu entschlossen, ihn zu idealisieren. Auf Anraten ihrer Lektorin Tay Hohoff hat sie sich ganz auf die paar als Rückblenden eingeschobenen Kindheitspassagen konzentriert und den „Wächter“ zur „Nachtigall“ umgeschneidert.
Der früher entstandene, aber bislang aus guten Gründen unpublizierte Roman ist weniger „literarische Sensation“ als vielmehr ein Beleg für das erstaunliche Potenzial literarischer Kreativität und für die Instinktsicherheit einer Lektorin die – wie die Kritikerin Gaby Wood anmerkte – eigentlich noch posthum mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet werden müsste.
Wer den Atticus der „Nachtigall“ vor Augen hat, für den stellt der „Wächter“ freilich einen Schock dar. Man fühle sich, meinte der Kritiker Mark Lawson, als wäre man soeben dahintergekommen, dass die Geschichte vom „Fänger im Roggen“ in Wirklichkeit der Traum eines pädophilen republikanischen Senators sei.
Dass sich die Wahrhaftigkeit oder Brisanz eines Buches danach bemesse, wie „hart“, „kompromisslos“ oder „unbequem“ diese sei, ist eine weit verbreitete Ansicht. Arifa Akbar, Literaturredakteurin des Independent, etwa befand, dass im Vergleich der „Wächter“ das radikalere, ambitioniertere und politischere Buch sei. Das mag schon zutreffen. Die Frage ist bloß, ob es deswegen auch schon das bessere ist.
Wirklich brisant wird es, als die mittlerweile 26-jährige Tochter, die hier nicht als „Scout“, sondern unter ihrem vollen Namen Jean Louise auftritt, unter den Zeitungen des Vaters auch eine Broschüre mit dem Titel „Die schwarze Pest“ findet. Als sie Atticus und ihren Jugendfreund Henry, in den sie „fast verliebt“ und mit dem sie fast verlobt ist, heimlich zu einer Bürgerversammlung folgt, muss sie entdecken, dass dort die übelsten politischen Rabauken widerliche Reden gegen „rotznäsige Nigger“, „Niggeranwälte“, „Niggerrichter“ und die „Niggerfreundin“ Eleanor Roosevelt schwingen.
Für Jean Louise bricht eine Welt zusammen: „Sie kannte sich nur wenig mit den Angelegenheiten von Männern aus, aber sie wusste, dass ihr Vater am selben Tisch mit einem Mann saß, dessen Mund Dreck spie … Machte das die Tirade weniger dreckig? Nein, es billigte sie. Ihr war übel. Ihr Magen verkrampfte sich, sie begann zu zittern.“
Atticus übernimmt zwar die Verteidigung von Schwarzen, allerdings lediglich, um zu verhindern, dass diese „in falsche Hände“ gerät: Von der NAACP, also der National Association for the Advancement of Colored People, bezahlte Anwälte würden „wie die Bussarde“ darauf lauern, dergleichen Fälle zu übernehmen.
Das politische Selbstverständnis des Atticus Finch beruht auf jenem „Leben und leben lassen“, das staatliche Intervention scheut wie der Teufel das Weihwasser und daran glaubt, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Wäre er noch am Leben, Atticus Finch würde in Obamacare einen Versuch der kommunistischen Unterwanderung erblicken, befände sich also weitgehend im politischen Mainstream der USA. Erst recht gilt dies für den amerikanischen Süden der 1950er-Jahre.
„Willst du scharenweise Neger in unseren Schulen und Kirchen und Theatern? Willst du sie in unserer Welt?“ Es ist fraglos verstörend und furchtbar, was Atticus da zu seiner Tochter sagt, die ihn auch prompt als „hinterhältigen, ringelschwänzigen Scheißkerl“ beschimpft. Tatsächlich haben hundertausende Töchter und Söhne noch in den 60er- und 70er-Jahre ähnliche Kämpfe mit ihren kirchengehenden, ÖVP oder sonst was wählenden, persönlich „hochanständigen“ Vätern ausgefochten.
„Er war privat derselbe Mensch wie in der Öffentlichkeit“ wird Atticus im „Wächter“ charakterisiert – ein Beobachtung, die mehr oder weniger wortgleich auch in der „Nachtigall“ vorkommt. Ansonsten finden sich nur wenige Passagen, die Harper Lee der Übernahme für Wert erachtet hat: im Wesentlichen spaßige Ausführungen zu diversen Gründungsmythen von Maycomb und die lustigste der zahlreichen Anspielungen auf den Umstand, dass die sogenannten Familien mit „Tradition“ alle ein Produkt der Inzucht sind: „Die Cunninghams heirateten die Coninghams, bis die Schreibweise der Namen nur noch theoretische Bedeutung hatte.“
Der Humor zählt denn auch zu den wesentlichen Unterschieden zwischen den beiden Büchern: Im „Wächter“ ist er allenfalls in Spurenelementen vorhanden. Das hat auch mit der Protagonistin zu tun. Jean Louise ist eine etwas selbstgerechte Nervensäge, die ihren Vater vergöttert und auf den Sturz ihres Idols mit hysterischer Aggression reagiert, ehe dieses dann trotz aller Narben und Kratzer restituiert wird: „Ich glaube, ich habe dich sehr lieb.“
Scout hingegen ist einfach ein unkaputtbarer weltliterarischer Charmebolzen von mannstoppender Wirkung, der selbstverständlich immer so aussehen wird wie die zehnjährige Mary Badham, die als jüngste Schauspielerin aller Zeiten für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert wurde.
Wer sich in diesen latzbehosten Fratz mit der frechen Schnauze und dem großen Herzen – im Übrigen die einzige Hauptfigur, die nie heult – nicht verliebt, muss falsch verkabelt sein. Scouts halsstarrige Loyalität, ihr gusseiserner Gerechtigkeitssinn und die ahnungslos tourettierenden Tobsuchtsanfälle, mit denen sie bei Tisch nach dem „verdammten Schinken“ verlangt oder ihren nervigen Cousin eine „alte Hure“ heißt, sind einfach hinreißend.
Dass die Sprache, die Harper Lee ihrer blutjungen Ich-Erzählerin in den Mund legt, alles andere als realistisch ist – keine Sechsjährige der Welt verfügt über einen solchen Wortschatz und über ein derartiges Feingefühl für sämtliche Valeurs von Ironie und Sarkasmus –, verschlägt nichts, denn der Trick funktioniert. Glaubwürdigkeit in der Literatur ist: die Leser dazu bringen, dass sie es glauben wollen.
Harper Lee selbst, der ihr Ruhm immer ein bisschen peinlich und ziemlich lästig war, wäre übrigens die Letzte, die ihren Status als One-Hit-Wonder bestreiten würde. Als ihr Freund Thomas Lane Butts, Methodistenpfarrer in Monroeville, sie vor einigen Jahren fragte, ob sie nicht doch daran dächte, noch einen zweiten Roman zu schreiben, verneinte sie brüsk. Nie wieder und um keine Summe der Welt wolle sie sich dem Druck der Öffentlichkeit so aussetzen wie vor 50 Jahren. Außerdem, fügte sie hinzu: „I have said what I wanted to say and I will not say it again.“
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: