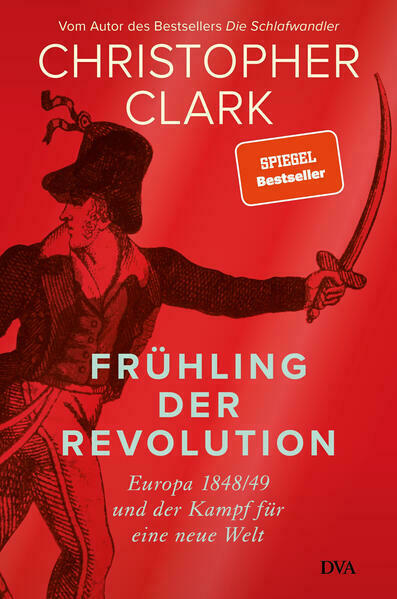Kaleidoskop der europäischen Revolutionen
Franz Fillafer in FALTER 50/2023 vom 13.12.2023 (S. 21)
Vom Umfang her waffenscheinpflichtig, ist Chris Clarks Buch ein ebenso kurzweiliges wie lehrreiches Lesevergnügen, das zeigt: Die Revolutionen von 1848/49 waren gesamteuropäisch, krempelten den Kontinent als Ganzes um, und man kann sie nicht als gescheitert abtun, wie es bisher oft geschah. Obwohl es Monarchen und Armeen 1849 überall gelang, die Revolution abzuwürgen, begründeten ihre liberalen und radikalen Vorkämpfer langfristig den parlamentarischen Verfassungsstaat.
Clark ist ein polyglotter Feinspitz, der portugiesische Zeitschriften und päpstliche Enzykliken ebenso auswertet wie das kroatische Tagebuch der Patriotin Dragojla Jarnević. Mit Fingerspitzengefühl widmet sich Clark der Akustik, Olfaktorik und Haptik der Revolution, fängt ihre Emotionen -Angst und Rührung, Zuversicht, Schmerz, Trauer - und ihre Alltagsgeschichte ein. Ergreifend schildert Clark den Trauerzug der Berliner Märzgefallenen, der Friedrich Wilhelm IV. eine Verbeugung vor den Toten abtrotzte.
Daraus folgt eine nachdrückliche Leseempfehlung für ein Buch, das kein Schlussstein der Forschung, sondern ein Ansporn für weiterführende Studien ist. Das zeigt sich an zwei Aspekten: Erstens löst Clark gekonnt den Gegensatz zwischen dem fortschrittlichen Westeuropa und dem angeblich reaktionär-rückständigen Zentral-und Südeuropa auf. Großbritannien ist nicht von der Revolution verschont geblieben, weil es ein Hort der Freiheit war, sondern weil Robert Peels Reformen soziale Spannungen entschärften; Steuererhöhungen und Unruhestifter wurden in die Kolonien ausgelagert, dem rebellischen Irland hatte die Hungersnot seit 1845 das Rückgrat gebrochen. Mit Blick auf die Weltpolitik folgt daraus, dass man die liberalen Schalmaientöne Großbritanniens nicht überbewerten darf: Wie das weniger humanistisch auftretende Russland strebte es nach der Absicherung von Besitzständen, notfalls durch militärische Intervention.
Zweitens fällt auf, wie sehr Clarks Europa zu einem Geschichtsraum verschmilzt, in dem dieselben Ideen und Akteure (Liberale, Radikale, Gegenrevolutionäre) am Werk waren. Jedes Kapitel verbindet Schauplätze von Palermo bis Paris, von Martinique bis Czernowitz. Ist diese "berauschende Gleichzeitigkeit"(Clark) aber nicht auch Resultat des geschmeidigen, das Buch zusammenhaltenden Narrativs? Jedenfalls verschwimmen so Unterschiede zwischen und innerhalb von Regionen.
Das ist deshalb keine Bagatelle, weil sich die Revolution unter spezifischen Bedingungen vollzog, je nachdem, ob sie sich in einem multireligiösen oder monokonfessionellen Reich abspielte, auf eine kapitalisierte Agrarwirtschaft oder autarke Versorgungseinheiten traf, ob Frauen vor Ort über ihr eigenes Vermögen verfügen konnten oder nicht, ob die lokalen Liberalen eher eine "klassenlose", d.h. berufsständisch-patriarchale, Bürgergesellschaft anstrebten oder Bahnbrecher des Freihandels waren. Im Panorama entsteht leicht der Eindruck, alle Beziehungen zwischen den Schauplätzen der Revolution seien gleichrangig.
Tatsächlich variierten die Qualität und die Dichte dieser Bezugnahmen sehr stark: Das betrifft sowohl die Übertragung von Vor-und Feindbildern als auch die sich entfaltenden Solidaritätsbeziehungen. Um solche Abweichungen in Zeit und Raum sichtbar zu machen, müsste neben die von Clark meisterlich dargestellte Verflechtung des Kontinents der Vergleich lokal verankerter Strukturen treten. Kurzum: Die europäische Perspektive hat als Suchbefehl viel für sich, darf aber nicht voraussetzen, was erst zu beweisen wäre.
Der Rezensent Franz L. Fillafer ist Historiker an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, wo er zur Geschichte Zentraleuropas seit dem 18. Jh. im globalen Kontext arbeitet. Zuvor forschte und lehrte er in Cambridge, London, Konstanz und Florenz
Frühling der Revolution
Tessa Szyszkowitz in FALTER 44/2023 vom 01.11.2023 (S. 20)
Gerade noch vor dem Ende des 175. Gedenkjahres der 1848er-Revolution kommt ein schöner Geschichtsknüller von Christopher Clark auf den Markt: "Frühling der Revolution -Europa 1848/49 und der Kampf für eine neue Welt." Der australische Historiker, der in Cambridge in Großbritannien unterrichtet, hatte schon mit "Die Schlafwandler" 2013 einen Bestseller gelandet.
Und wieder reißt Clark die Leser mit. Die Revolution 1848 -heute oft vergessen, weil die Konterrevolution erst einmal gewann -hat natürlich ganz allein die tollsten Geschichten geschrieben. Aber Clark komponiert sie mit Verve und Witz neu. Da wäre die Geschichte der deutschen Revolutionärin Mathilde Franziska Anneke. Sie nahm mit ihrem Mann Fritz am Badischen Aufstand teil: als berittene Botin für die aufständischen Truppen. 1849 musste das Ehepaar fliehen. Sie gründete dann im amerikanischen Exil die erste von einer Frau geführte feministische Zeitschrift des Landes, die Deutsche Frauen-Zeitung. Später trennte sie sich von ihrem Mann und kehrte mit ihrer Lebensgefährtin Mary Booth nach Europa zurück, wo sich das "bikulturelle Autorenteam" für die Abschaffung der Sklaverei und für Frauenrechte einsetzte.
Clark erzählt nicht nur das Entstehen der Frauenbewegung, er zeigt auch, wodurch die Ideen von 1848 übersprangen: "Imperiale Strukturen, postkoloniale soziale und kulturelle Bindungen, die migrantische Diaspora und gemeinsame Institutionen." Das britische Empire und das Habsburgerreich sind gute Beispiele dafür. Nach der Niederschlagung der bürgerlichen Revolution regierten die Monarchen noch lange weiter.
Wie war das möglich? Clark: "Konterrevolutionäre waren -in ihren eigenen Augen - meistens die Vollstrecker der Revolution und nicht deren Totengräber." Alexander von Bach, einst als Demokrat verdächtigt, wurde 1849 Innenminister. Ein Verräter? Oder einer, der den langen Marsch durch die Institutionen angetreten hatte? So schlichen sich mit 1848 Veränderungen langsam, aber sicher in Österreich ein.