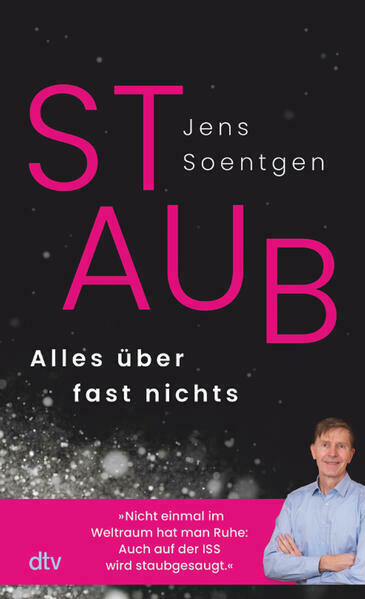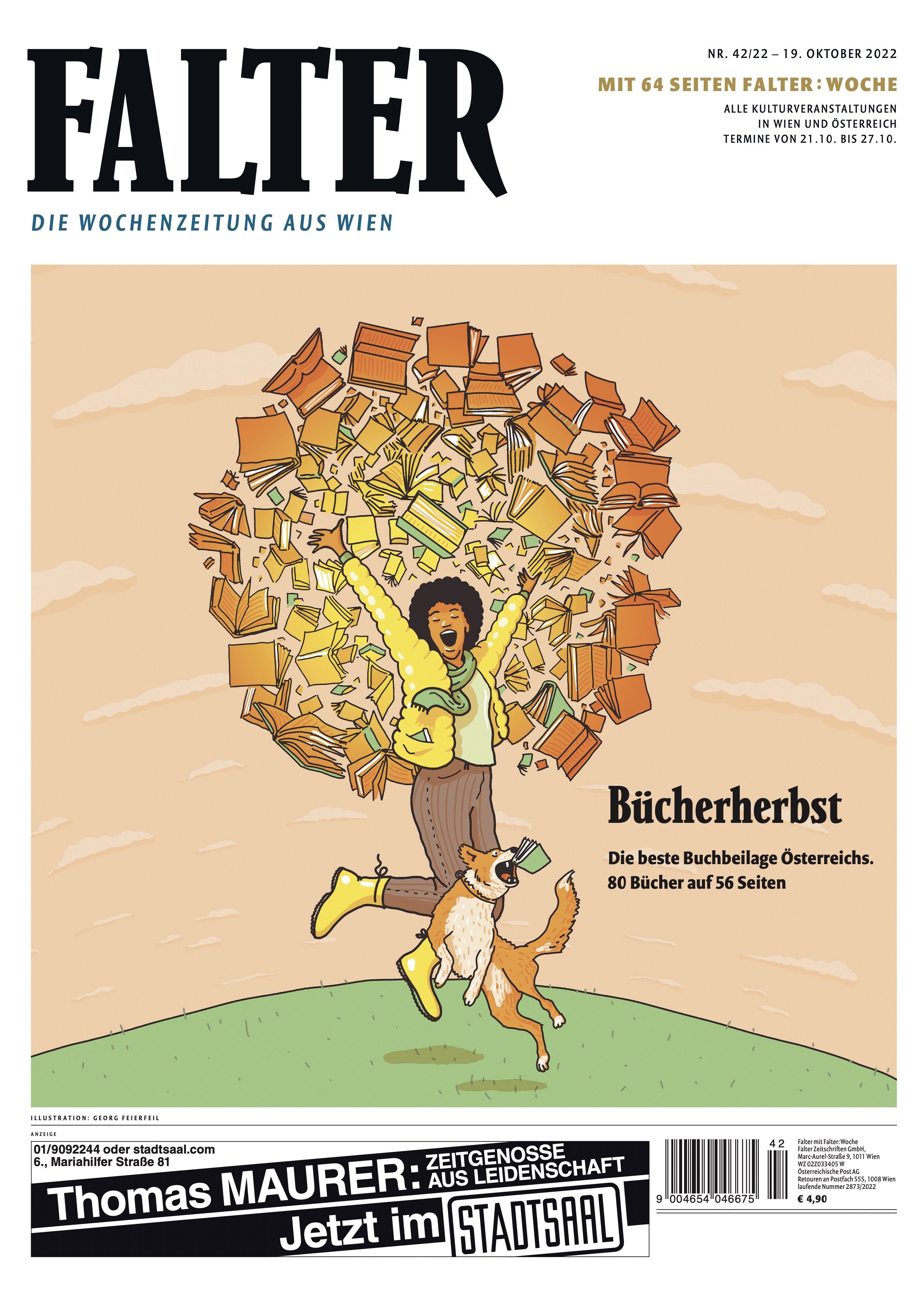
Asche zu Asche, Staub zu Staub
Anna Goldenberg in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 22)
Rund sechs Zentimeter ist das Samtband breit. Mit Perlen oder Stickereien verziert, tragen es Frauen als Teil der alpinen Tracht um den Hals. Das prächtige Schmuckstück hat einen uneleganten Namen -und seine Geschichte ist eng mit jener des Staubs verbunden: Das sogenannte Kropfband diente einst dazu, eine Schwellung des Halses oder die Narben der Operation zu verdecken. Dieser Kropf, nun Struma genannt, wird von einer Unterfunktion der Schilddrüse verursacht.
Heute selten, war die Krankheit bis ins 19. Jahrhundert in Gebirgsregionen häufig -nicht nur in den Alpen. Dem Naturforscher Alexander Humboldt fiel auf, dass auch Menschen im kolumbianischen Hochland daran litten. Nicht aber jene, die an Küstenregionen lebten.
Wie konnte das sein? Ein französischer Chemiker entdeckte schließlich Jodmangel als Ursache. Das Spurenelement Jod ist Bestandteil des Schilddrüsenhormons und für den Stoffwechsel wichtig. Jod ist auch im Meereswasser enthalten, weil es von den winzigen Meeresorganismen akkumuliert wird. Durch die Gischt gelangt es in die Luft. Wer Meeresluft inhaliert, atmet auch Jod ein. Oder, streng genommen, Jod-Staub.
In einem neuen Buch liefert der deutsche Philosophieprofessor Jens Soentgen eine Wissenschafts-und Kulturgeschichte des Staubs. Staub, das sind die kleinen Teilchen, die in der Luft schweben können, weil sie mehr Oberfläche als Masse haben. Die Mischung aus Partikeln und Gasen, also Luft, bezeichnet die Forschung auch als Aerosol, ein aus dem Griechischen und Lateinischen zusammengesetztes Kunstwort, das "Luftlösung" bedeutet.
Ob Coronaviren oder Jod, Blütenpollen oder Wassertröpfchen, Asbest oder Saharastaub, unzählige kleinste Objekte werden so transportiert. Die Aerosolpartikel sind mal lebensnotwendig, mal lebensgefährlich -und meist für das menschliche Auge unsichtbar.
"Staub ist ein Kulturfolger", schreibt Soentgen, Menschen hätten eine "Hassliebe" zu ihm. Der Hausstaub ist ein jahrtausendealtes Mühsal. Staubflusen, auch Wollmäuse genannt, bestehen aus Fasern, Mineralpartikeln, Krümeln und menschlichen Hautschuppen. Besonders häufig sind sie dort, wo viele Textilien vorhanden sind und diese regelmäßig bewegt werden, wodurch sie einzelne Fasern verlieren -also beispielsweise im Schlafzimmer. Große Partikel ziehen kleinere an und binden sie.
Aber warum funktioniert das nicht umgekehrt, zersetzt sich zwar der Pullover in Flusen, entsteht aber aus den Flusen nicht wieder ein Pullover? Dafür ist ein physikalisches Gesetz aus dem Bereich der Thermodynamik verantwortlich: die Entropie. Sie besagt, dass die Unordnung stetig zunimmt.
Gleichzeitig macht sich der Mensch eine andere physikalische Eigenschaft der Partikel zunutze, nämlich ihre hohe Reaktivität. Die Teilchen haben kein Inneres, das durch eine Hautschicht getrennt ist. Dadurch sind sie extrem empfindlich. Geriebenes Eisenpulver explodiert, wenn man es rieseln lässt; gemahlener Pfeffer schmeckt schärfer als das Korn; Staubzucker löst sich schneller auf als Kandiszucker.
Der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz bezeichnete Staub als "Garten voller Pflanzen und ein Teich voller Fische". Und tatsächlich ist die Welt der Partikel eine vielfältige. Wie divers sie ist, was die Teilchen antreibt und wohin sie reisen, damit beschäftigt sich die Aerosolforschung, die sich Mitte des 20. Jahrhunderts etablierte.
Zwischen wenigen Nanometern und mehreren hundert Mikrometern ist ein Partikel groß, das schweben kann. Ein Mikrometer ist ein tausendstel Millimeter, ein Nanometer ein tausendstel Mikrometer. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von rund hundert Mikrometern. Als Feinstaub (sogenanntes PM10) werden Partikel bezeichnet, die kleiner als zehn Mikrometer sind. Denn bis zu dieser Größe filtert die menschliche Nase sie raus. PM10-Partikel gelangen in den oberen Lungenraum, PM2,5, also Partikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind, schaffen es bis zu den Bronchiolen.
Dass zu viel Feinstaub die Gesundheit belastet und die Sterblichkeit erhöht, haben mittlerweile zahlreiche Studien bestätigt. Aber: Staub ist nicht gleich Staub. Nicht jedes Partikel, das in die Lunge gelangt, ist gefährlich.
Rund 13 Kubikmeter Luft nimmt der Mensch täglich auf; das entspricht 13.000 Milchflaschen. Welche Aerosolpartikel sind da dabei? Global gesehen machen die Salzpartikel aus den Ozeanen fünf Sechstel der Masse aus. Weitere 15 Prozent gelten als anthropogen, als von Menschen gemacht - etwa der Ruß, der beim Verbrennen entsteht. "Je nachdem, wo man sich befindet, ist diese Verteilung unterschiedlich", sagt Bernadett Weinzierl. In der Stadt gibt es mehr Ruß als in unbewohnten Gegenden. "Zudem wird noch diskutiert, wie hoch der menschgemachte Anteil am Aerosol ist."
Weinzierl leitet die Forschungsgruppe für Aerosol-und Umweltphysik an der Fakultät für Physik der Universität Wien. Besonders interessiert sie der Mineralstaub, der tausende Kilometer reisen kann. Eine große Mineralstaubquelle ist die Saharawüste. Dort kommt ein großer Anteil aus der Bodélé-Depression, ein höchst unwirtlicher Ort auf dem Staatsgebiet des Tschad. Die Senke ist so groß wie die Niederlande, an rund 100 Tagen im Jahr wirbeln über sie Sandstürme hinweg. Was sie für Weinzierls Forschung ideal macht. Wie weit reist dieser Saharastaub, der es mehrmals im Jahr auch über die Alpen nach Österreich schafft?
Gemessen wird der Staub mit speziell präparierten Flugzeugen. Sie haben Einlässe in der Flugzeughülle, durch die Partikel eingesaugt und von Instrumenten im Inneren gemessen werden. Diese Forschungsflüge führte Weinzierl in der Sahara, auf den Kapverdischen Inseln im Atlantik und in der Karibik durch. "Uns interessiert, wie sich die Größe der Partikel verändert, wenn sich Staub über größere Strecken bewegt."
Eine Frage, die unter anderem deshalb relevant ist, weil der Staub das Wetter bestimmt. Wolken und Niederschlag brauchen die Aerosolpartikel, egal, ob sie natürlich oder menschengemacht sind. Das funktioniert folgendermaßen: Die Sonne heizt den Erdboden und die Ozeane auf; Wasser verdunstet. Der Wasserdampf steigt auf und kühlt in der Höhenluft wieder ab.
Doch die Luftfeuchtigkeit ist nicht hoch genug, damit er von allein wieder stabile Wassertropfen formen, also kondensieren kann. Dafür ist er auf sogenannte Kondensationskeime angewiesen -die Aerosolpartikel. Sie bieten den Tröpfchen eine Landefläche. Um die Partikel bildet sich eine Wasserhülle, Tropfen können entstehen.
"Deshalb bildet sich über großen Städten, in denen viele Abgase ausgestoßen werden, auch häufiger Nebel und Dunst", sagt Thomas Wostal von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Sind viele Partikel in der Luft, formt das Wasser viele kleine Tröpfchen. Anders über sauberen Gegenden: Hier entstehen dicke Regentropfen, die rasch wieder abregnen - denn die Wassertröpfchen müssen sich auf weniger Kondensationskeime verteilen.
Der Mineralstaub in der Luft beeinflusst auch die Farbe des Himmels; er sieht dann weißlich aus. Das liegt daran, dass die großen Mineralstaubpartikel alle Farben des Sonnenlichts gleich stark streuen. Farbige Sonnenuntergänge entstehen hingegen durch Streuung an sehr kleinen Aerosolpartikeln, die beispielsweise aus Verkehrsund Industrieabgasen entstehen. Sie streuen blaues Licht sehr viel stärker als gelbes und rotes Licht.
Es ist längst nicht nur das Kropfband; dem Staub verdanken wir möglicherweise auch das vielleicht wichtigste mathematische Zeichen: die Null. Diese These vertritt der Mathematiker Robert S. Kaplan von der Harvard-Universität. Vor deren Erfindung hatte man in Spalten für Hunderter, Zehner und Einser gerechnet; Kieselsteine stellten die Zahl dar. Später stieg man auf Rechenbretter um, die man mit Staub bedeckte, um die Rechnungen danach zu überprüfen. Nahm man die Kieselsteine weg, blieben die Abdrücke zurück. Und die runde Form soll die Inspiration für die Null gegeben haben.