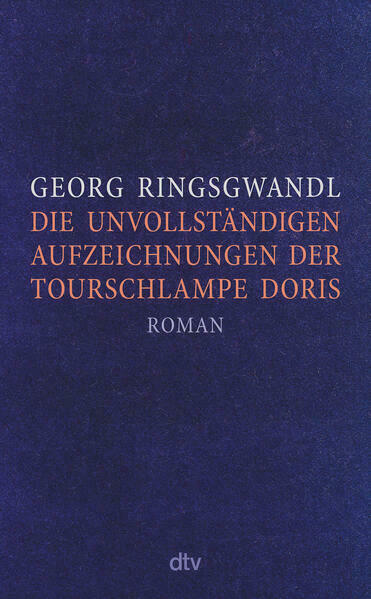"Nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass ich für einen Roman ZU DUMM BIN"
Wolfgang Kralicek in FALTER 46/2023 vom 15.11.2023 (S. 5)
Seine Biografie ist eine "gute G'schicht'". Jahrelang führte Georg Ringsgwandl, 75, ein Jekyll-und-Hyde-Doppelleben. Tagsüber operierte er als Kardiologe am offenen Herzen, nachts stand er grell geschminkt auf verrauchten Bühnen. Die Kritik feierte den abgedrehten Liedermacher als "Punk-Qualtinger", Ringsgwandl wurde mit Kleinkunstpreisen dekoriert und war irgendwann so erfolgreich, dass er den Job als Oberarzt in der Klinik aufgeben musste.
Seit 30 Jahren widmet er sich ganz seiner Musikerkarriere. Die Schminke und den Fummel der frühen Jahre hat er längst abgelegt, Ringsgwandl ist als Singer/Songwriter mit bluesigem Sound und bayerisch geerdeten Texten etabliert. Daneben hegt er auch literarische Ambitionen. Er nahm am Wettlesen um den Bachmann-Preis teil, schrieb Theaterstücke und Erzählungen.
Unlängst ist sein erster Roman erschienen. Er heißt "Die unvollständigen Aufzeichnungen der Tourschlampe Doris" und erzählt eine gute Geschichte: Ringsgwandls Biografie.
Falter: Herr Doktor, Sie sind gerade mit Ihrem neuen Album "Arge Disko" auf Tour. Das Problem ist nur: Es gibt noch kein Album. Was ist schiefgelaufen?
Georg Ringsgwandl: Die Songs sind fertig geschrieben, aber mit der Aufnahme hat es einfach nicht rechtzeitig geklappt. Mein Roman hat mich länger beschäftigt als gedacht, das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Live spielen wir die neuen Songs natürlich, aber die Platte kommt dann halt erst nach der Tour.
Sie haben in den vergangen Jahren wiederholt von einem Roman gesprochen, an dem Sie arbeiten. Ist er das jetzt?
Ringsgwandl: Ja, das ist er. Die Idee ist schon etwas älter, und ich habe über die Jahre immer wieder daran geschrieben. Die erste Version hatte 1300 Seiten. Da hab ich mir gedacht: Das kannst du nicht machen, die armen Menschen! Dann hab ich's auf 650 gekürzt, aber das war immer noch zu viel, ich heiße ja nicht Dostojewski. Mein Ideal wären so 260 Seiten gewesen, wie bei Joseph Roth. Das hab ich nicht ganz geschafft.
Klingt nach einer schweren Geburt.
Ringsgwandl: Ich habe öfter gedacht: Jetzt nehme ich diese Ordner mit den Notizen und Entwürfen und lasse sie von einem Schlosser luftdicht in eine Metallkiste einschweißen. Ich habe jahrelang daran gearbeitet, einen erträglichen Ton für das Buch zu finden. Wer wissen will, was wirklich eine harte Hack'n ist, der soll einmal ein Buch schreiben. Ich kann drei Steher Holz weghacken und einen Garten umgraben - das ist ein Spaziergang im Vergleich zu einem Prosatext. Ich hab ein paar Theaterstücke geschrieben und einen Band mit Kurzgeschichten, aber es ist ein Unterschied, ob das ein Erzählbogen über zehn, 20 Seiten ist oder ob sich das Ganze über eine längere Strecke bewegt. So ein Roman ist eine Übung in Demut.
Im Roman wird Ihre Geschichte erzählt - und zwar aus der Perspektive von Doris, einer jungen "Tourschlampe", die mit der Band unterwegs ist. Eine um die Ecke erzählte Autobiografie?
Ringsgwandl: Autobiografien sind, mit extrem wenigen Ausnahmen, eine Zumutung. In der Sekunde, in der jemand glaubt, dass er was Besonderes ist oder was Besonderes gemacht hat, gehört das Buch schon in die Mülltonne. Das ist unerträglich! Deswegen war ich sehr froh, dass die Doris diese Aufzeichnungen hinterlassen hat.
Und diese Geschichte war einfach zu gut, um sie nicht aufzuschreiben?
Ringsgwandl: Während all der vielen dunklen Stunden oder Tage habe ich mir oft gedacht: Ich schaff das nicht, ich bin zu blöd dafür! Nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass ich für einen Roman zu dumm bin. Da brauchst du einfach einen Kopf, der jünger und größer ist. Und doch war mir immer auch klar: Es is a guate Gschicht!
Das Buch handelt über weite Strecken vom Leben als Künstler auf Tour. Was ist das Faszinierende daran?
Ringsgwandl: Ich hätte nie gedacht, dass sich jemals irgendein Schwanz in Kiel, in Hamburg oder in Bremen meine Lieder anhört - geschweige denn irgendwo im hinteren Österreich. Aber an sich ist das Tourleben eine reine Zumutung. Wenn man Tourneen ohne Reisen machen könnte, wäre mir das viel lieber. Aber leider bin ich nicht der Billy Joel, der seit Jahren einmal im Monat im Madison Square Garden spielt und sonst nirgendwo.
Im Buch ist auch von Ihren endlosen Monologen im Auto die Rede, in denen
manchmal Ideen für Songs enthalten waren. Ringsgwandl: In der Tat sind viele Songs auf der Tour entstanden. Es gibt Bands, die machen den Soundcheck wirklich als Soundcheck, aber nach zwei, drei Konzerten ist das ja eine blödsinnige Übung. Wir nutzen den Soundcheck, um am Nachmittag irgendwas auszuprobieren, eine Harmoniefolge oder eine neue Textzeile, sodass die Tour zu einer Art fahrendem Labor wird. So kannst du 40,50 Konzerte spielen, ohne dass es langweilig wird. In Kukmirn kriegen sie die Rohfassung, in Graz klingt es schon ein bissl besser, und in Leobendorf ist es schon fast perfekt.
Sie kennen die burgenländische Gemeinde Kukmirn? Ringsgwandl: Also, wenn einer Kukmirn nicht kennt, brauchst du mit dem gar nicht reden!
Ein zentrales Motiv des Buchs ist die Suche nach dem wahren Rock 'n'Roll. Was genau verbinden Sie eigentlich damit?
Ringsgwandl: Mit Bill Haley und Chuck Berry hat mein Rock 'n'Roll nur wenig zu tun. Für mich ist das eine Metapher für eine bestimmte Lebensauffassung, einen bestimmten Lebensstil. Der sich möglichst wenig um Regeln und Korrektheiten kümmert, stattdessen einfach aus einem minimalen Set von basalem menschlichem Anstand besteht - und ansonsten möglichst jeden Exzess auslebt, solange man dabei nicht über die Wupper geht. Das ist eine problematische Geschichte, weil sie natürlich nur in sehr geringen Teilen mit dem normalen bürgerlichen Leben vereinbar ist. Wenn du Familie hast, ist für den Rock 'n'Roll relativ wenig Platz. Heutzutage eigentlich null Komma null Platz.
Wie geht es dem Rock 'n'Roll anno 2023?
Ringsgwandl: Man kann meiner Generation vorwerfen, dass wir diese Musik als Hintergrundfolie für ein punktuell ausschweifendes Leben benutzt haben. Für viele Leute war diese etwas saloppe, hedonistische Lebensform viel wichtiger als die Musik im Hintergrund. Heutzutage haben die Musiker alle einen Führerschein, sie beherrschen ihre Instrumente richtig gut, haben keine Suchtprobleme. Meine Generation sagt: Naja, die spielen zwar perfekt, aber sie sind Langweiler! Damit wird man ihnen nicht ganz gerecht. Diese jungen Musiker -jung heißt bei mir alles, was unter 50 ist - sind in einer anderen Zeit aufgewachsen, mit anderen Problemen, in einer komplett anderen Welt, also ist die Musik auch anders. Insofern ist jegliche Häme unangebracht.
Viele Ältere behaupten ja, dass in den 70er-Jahren zumindest musikalisch alles besser war.
Ringsgwandl: Natürlich hatten die 70er-Jahre etwas, was so verboten und exzessiv schön war, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mir anschaue, in welcher Welt meine Töchter aufwachsen. Die haben nie auch nur den Hauch dessen erlebt, was man in den 70ern haben konnte. Nicht, dass damals alles besser gewesen wäre. Aber ich rede von einer Zeit, in der es schon die Pille gegeben hat, aber noch kein Aids. Die Schrecken der Nachkriegszeit waren allmählich verflogen, die Gesellschaft war relativ frei, die Kultur hat geballert und alles Böse war hinter dem Eisernen Vorhang. Das war schon eine sehr nette Zeit.
Aber würde man manches, was in den 70ern unter "Rock-'n'-Roll-Lifestyle" gelaufen ist, heute nicht eher als sexuellen Missbrauch bezeichnen?
Ringsgwandl: "Sexueller Missbrauch in den 70er-Jahren" - das wäre einmal ein gutes Kabarettprogramm, haha! Ich kann nix dazu sagen, weil damals hat's noch keine Groupies gegeben, die sich für mich interessiert hätten. Und wie ich das mit der Musik dann professionell betrieben habe, sind die Groupies schon alle mit dem Kinderwagen herumgefahren. In der Beziehung bin ich also komplett unqualifiziert. Ich weiß nur, dass diese Zeit auf eine Art und Weise unbefangen exzessiv war. Nicht für alle Leute, es hat hat auch in meiner Generation welche gegeben, die kurz nach dem Abitur geheiratet haben.
Zu Beginn Ihrer künstlerischen Karriere waren Sie neben Ihren Auftritten noch ganz regulär als Arzt tätig. Im Buch ist nachzulesen, wie Sie es manchmal nur knapp rechtzeitig in die Klinik geschafft haben. Irgendwann hat der Musiker dann den Arzt ausgestochen?
Ringsgwandl: Ich habe das sieben Jahre lang parallel gemacht, dann ging's einfach nimmer. Ein gutes Jahr lang war ich chronisch missmutig, das war so eine Mischung aus Depression und Aggression. Heutzutage würde man sagen: "Der Typ hat ein Burnout, er braucht ein Sabbatical." Das hat's damals aber beides noch nicht gegeben. Es war schlicht und einfach so, dass ich mich entscheiden musste, ob ich in der Klinik bleibe oder Musiker bin. Eines von beiden muss ich aufgeben oder auf ein Hobbymaß zurückfahren. Ich war damals immerhin schon 44 - es war also langsam Zeit, sich zu überlegen, was man macht.
In der Band wurden zeitweise Drogen konsumiert, leichtere und härtere. Sie selbst haben nur Bier genommen, wenn man dem Buch glauben darf.
Ringsgwandl: In den ersten Jahren hab ich immer etwas trinken müssen, damit ich mich überhaupt auf die Bühne trau. Das hab ich mir im Lauf der Zeit dann abgewöhnt. Ganz früher hab ich ab und zu an einem Joint gezogen, aber ich hab das nie richtig vertragen. Von Koks hab ich mich immer ferngehalten. Erstens war ich ohnehin schon die ganze Zeit überdreht, und zweitens hab ich gesehen, wie die Leut beinander waren, die das genommen haben. Das hat mich als Doktor abgeschreckt.
Finger weg von den Drogen also?
Ringsgwandl: Ich hab ein paar Mal aus medizinischen Gründen Morphin gekriegt, das ist wirklich ein Genuss. Aber auch davon hab ich mich ferngehalten, weil mir immer klar war, dass das sofort zu einer katastrophalen Sucht führt. Das gute, reine Morphin der pharmazeutischen Industrie ist was sehr Schönes. Aber ich weiß: Der erste Schuss ist Wahnsinn, der zweite Schuss ist halb so lustig -und dann artet es in Sucht und Elend aus.
Viel Raum geben Sie dem Schwarzgeld, das Doris in der Schweiz bunkert. Sie scheinen das nicht besonders kritisch zu sehen.
Ringsgwandl: Schwarzgeld ist heutzutage ja verfemt, bald gibt es eine Generation, die gar nicht mehr weiß, was das ist. Oder sie kennen es nur noch aus alten Mafiafilmen. Aber in den 70er-und 80er-Jahren war das in der gesamten Musikszene ein wesentlicher Faktor. Speziell für Musiker, die noch nicht so wahnsinnig viel verdient haben, war Schwarzgeld ganz wichtig. Weil es einfach ein Unterschied ist, ob du von 10.000 Mark die Hälfte abgeben musst oder ob die 10.000 Mark wirklich dir gehören. Das hat einen gewissen Charme. Es war damals eine Art Gesellschaftsspiel zwischen der Musikszene und den Finanzämtern, bei dem es darauf ankam, dass der eine den anderen nicht unterschätzt. Dass man sich mit Respekt begegnet.
Im Roman taucht dann irgendwann der erste Veranstalter mit Laptop auf. War damit das Spiel aus? Ringsgwandl: Als der erste Idiot stolz darauf war, dass er den gesamten Vorverkauf im Computer drin hat, war das das Ende der schönen Zeit.
Bleibt es bei dem einen Roman?
Ringsgwandl: Ich habe 30 Jahre gebraucht, bevor ich einen halbwegs lesbaren Prosatext hingekriegt habe, da möchte ich schon wieder was schreiben. Letzten Endes ist immer die Frage: Wird jemand Lebenszeit dafür opfern, um das zu lesen?
Wenn man das wüsste!
Ringsgwandl: Das ist aber auch das Interessante daran und Gott sei Dank nicht wie in der Medizin, wo alles zertifiziert wird. "Jeder Roman ist ein Risiko", hat Jonathan Franzen einmal geschrieben. Da hat er recht. Du machst es, so gut es geht. Und dann urteilt die Welt darüber.
Ein Roman ist halt so viel Arbeit. Wäre das dann nicht besonders hart, wenn sich niemand dafür interessiert?
Ringsgwandl: Ich hab mir irgendwann gedacht: Selbst wenn das niemand liest, selbst wenn alle großen Zeitungen schreiben, was für ein Scheiß das ist - der Roman muss so sein, dass ich sage: Es war die Arbeit wert, ich freue mich darüber, für mich ist er schön geworden.
Wie wär es als Nächstes mit einem Arztroman?
Ringsgwandl: Ich weiß nicht, ob ich noch die Zeit dafür habe, aber zwei Bücher täte ich gern noch versuchen. Eines über die Welt der Siedlung, wo der kleine Ringsgwandl-Schorschi durch diese Nachkriegszeit geprügelt wurde. Und eines über die Zeit als Arzt. Vielleicht so als Gegenentwurf zu "Schwarzwaldklinik". Was passiert, wenn die Kameras ausgeschaltet sind?
Wie ging es Ihnen als Arzt mit Kolleginnen und Kollegen aus der Welt der Kunst, die sich kritisch zu Corona-Maßnahmen geäußert haben?
Ringsgwandl: Diese Sache ist medizinischwissenschaftlich so komplex, dass selbst ein sehr gut informierter Doktor große Schwierigkeiten hat, es zu kapieren. Und der Letzte, der sich dazu äußern sollte, ist ein mehr oder weniger unzurechnungsfähiger Bühnenkünstler. Deswegen habe ich dazu kein Wort verloren. Und die, die es gemacht haben, sind weniger ein Fall für den Virologen als für den Psychiater. In meinem privaten Umfeld gibt's viele, bei denen ich die Freundschaft über die Corona-Zeit nur durch maximal ausgedehnte Toleranz aufrechterhalten konnte. Wenn ich da streng gewesen wäre, hätte ich einen großen Teil von meinem Bekanntenkreis schrotten müssen. Und das wollte ich nicht.
„Unser Tourarzt steht vorn am Mikro“
Wolfgang Kralicek in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 21)
Wer einen Roman schreiben will, braucht eine interessante Romanfigur. Es vereinfacht die Sache, wenn man selbst eine ist. So wie Georg Ringsgwandl, der Doktor mit dem Doppelleben: Jahrelang operierte er tagsüber als Kardiologe am offenen Herzen und stand abends als grell geschminkter Punk-Clown in verrauchten Kellerlokalen auf der Bühne.
Ringsgwandl hatte schon drei Schallplatten veröffentlicht und mehrere Kleinkunstpreise gewonnen, als er Anfang 1993 den Dienst als Oberarzt quittierte und sich ganz seiner Musikerkarriere widmete. Darüber hinaus hat er seit langem auch literarische Ambitionen. 1994 nahm er am Wettlesen um den Bachmann-Preis teil (und ging leer aus), er schrieb mehrere Bühnenstücke (darunter „Die Tankstelle der Verdammten“) und veröffentlichte einen Band mit Kurzprosa. Der immer wieder angekündigte Roman aber ließ auf sich warten. „Die unvollständigen Aufzeichnungen der Tourschlampe Doris“ ist nun dieser Roman, und siehe da: Er erzählt Ringsgwandls eigene Geschichte.
Wir haben es also mit einem autobiografischen oder, wie man heute sagt, autofiktionalen Werk zu tun. Das liegt bei einem Jekyll-und-Hyde-Leben wie diesem nahe. Dass der Autor so lange gebraucht hat, liegt vielleicht daran, dass er erst herausfinden musste, wie er dieses aufschreiben soll, ohne dass es eitel wird.
Die Lösung: Ringsgwandl lässt eine fiktive junge Frau namens Doris erzählen. 1984, da ist sie zehn, fängt Doris bei den Ringsgwandls in Garmisch-Partenkirchen als Babysitterin an, mit zwölf ist sie erstmals bei einem Konzert dabei und verkauft anschließend Platten. Ein Vierteljahrhundert ist sie als Mädchen für alles mit Ringsgwandl auf Tour, ehe sie 2010 auf einmal abtaucht. Wie sich herausstellt, hatte sie sich während all der Jahre Notizen gemacht. Ringsgwandl selbst hat diese gesichtet und stark gekürzt, angeblich wären es sonst mehr als 1000 Seiten geworden. Und: „Textstellen, in denen sie nach meinem Empfinden zu streng mit mir ins Gericht geht, habe ich abgemildert oder gestrichen.“
Aller Anfang ist hart. Anstelle eines Tourbusses gibt’s einen alten Mercedes, statt einer Hotelsuite ein ungeheiztes WG-Zimmer. Einmal hat der Veranstalter aufs Plakatieren vergessen, es sind nur drei Zuschauer da – und die haben sich im Datum geirrt, wollten eigentlich das Sun Ra Arkestra sehen. Irgendwo hat Doris gelesen, dass Udo Lindenberg auf Tour einen eigenen Arzt dabei hat. „Wir sind noch nicht so erfolgreich“, notiert sie, „dafür steht unser Tourarzt aber vorn am Mikro.“
Langsam wird es besser. Ringsgwandl darf auf Open-Air-Konzerten vor Bap oder Van Morrison spielen, und dass manche der Hotels, in denen sie inzwischen absteigen, sogar einen Swimmingpool haben, bedeutet für Doris den endgültigen Durchbruch: „Du hast es geschafft, sobald du auf Tour einen Badeanzug mitnehmen musst.“
Der Charme des Buchs besteht nicht zuletzt darin, dass es eigentlich Doris’ Geschichte ist, die hier erzählt wird. In einer der besten Szenen schildert sie einen Campingurlaub mit ihrem Vater, der mit seiner Tochter leider gar nichts anfangen kann.
Ringsgwandl selbst hingegen spielt in seiner Autobiografie fast nur eine Nebenrolle. Er ist der komische Vogel, der im Tour-Benz auf dem Beifahrersitz hockt und stundenlang vor sich hin spintisiert. So entstehen die aberwitzig verschraubten Geschichten, die er bei Auftritten zwischen den Songs erzählt. „R gehört zu einer Tierart, die Ideen in Gesellschaft produziert“, notiert Doris.
Deutlich schweigsamer sind seine Musiker. Einmal machen Ringsgwandl und Doris ein Experiment: Sie warten, wie lange es dauert, bis einer der Musiker von sich aus etwas sagt. Erst nach vier Stunden und 20 Minuten bricht Nick, der englische Gitarrist der Band, das Schweigen. Als er bemerkt, dass das Auto zu einer Raststätte abbiegt, nuschelt er: „Yeah, great, time for a cigarette.“
Eine der lustigsten Figuren im Buch ist ein Wiener Keyboarder, den Ringswandl in den 90er-Jahren für eine Tournee engagierte. Der Mann, der sich Wawa nennt, bekrittelt den Bassisten („Des muaßt mit de Eier spüün, host mi?“), kopuliert bei jeder Gelegenheit mit der Merchandise-Frau und haut Doris dauernd um Vorschuss („an Schuuuß“) an, weil er seinen Kokainbedarf finanzieren muss.
Das schlimmste Drogenproblem aber hat der heroinabhängige Bassist Jay, in den sich Doris leider trotzdem verliebt: „Ich hätte Trainspotting früher lesen sollen.“ Ringsgwandl selbst trinkt vor dem Auftritt zwar seine ein, zwei Bier, um Hemmungen abzubauen, hat Härteres aber nicht nötig – er ist auch so aufgedreht genug.
In Graz zuckt er nach einem Konzert hinter der Bühne komplett aus, wirft mit Gegenständen und Verwünschungen um sich. Den Ausraster wird er später so begründen: Weil ihm der 3-Wetter-Taft ausgegangen war, hatte er sich die Haare mit Cola hochtoupiert; über die Kopfhaut gelangte das Koffein ins Blut, wo es sich mit Alkohol zu einem fatalen Cocktail vermischte.
Wie viele Künstler leidet anscheinend auch Ringsgwandl an einer milden Form von bipolarer Störung. Auf ekstatische Auftritte folgen melancholische Phasen. „R meint, die guten Sachen kämen alle aus der Depression“, notiert Doris. „Warum soll einer Songs schreiben, wenn er gut drauf ist?“
Selten ist das Rock-’n’-Roll-Leben so anschaulich geschildert worden wie in diesem Buch. Am besten fand Doris die Phase um 1995, als das Livealbum „Der Gaudibursch vom Hindukusch“ entstand. Leider fehlen ihr die Worte dafür: „Was soll ich sagen? Nabokov war nicht dabei, und ich kann es nicht beschreiben.“