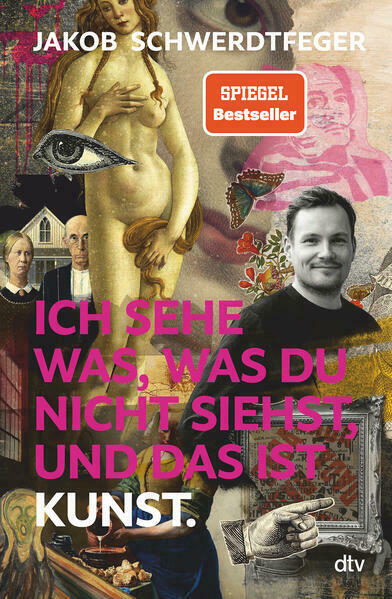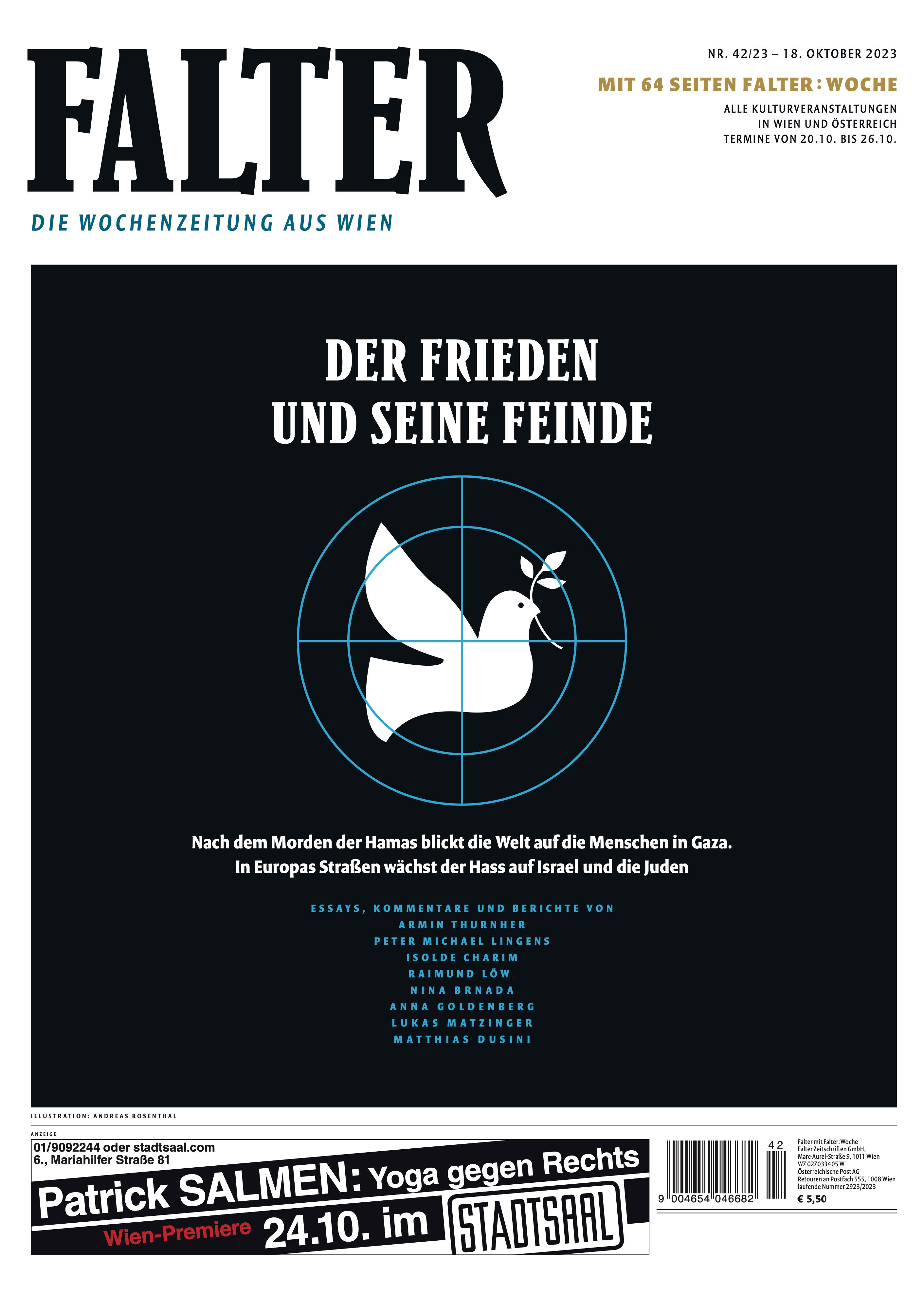
Gags, Gags, Gags der Kunstgeschichte
Juliane Fischer in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 45)
Ein dunkler Raum, das einzige Licht kommt aus einem Mauseloch in der Sockelleiste. Das wirft zur Titelmusik von „Tom & Jerry“ das Kopfkino an. Was Jakob Schwerdtfeger bei „Waiting for Jerry“ klar wurde, hatte der Universalgelehrte Leonardo da Vinci sinngemäß so formuliert: „Kunst ist die zweite Schöpfung mittels der Phantasie.“ Es braucht Vorstellungsvermögen und eine Geschichte hinter dem Werk.
Der studierte Kunsthistoriker Schwerdtfeger arbeitet als Stand-up-Comedian, gestaltet einen Podcast sowie Clips und Fotoserien auf Instagram, Youtube und Tiktok (etwa „Hässliche Schuhe auf der Art Basel“). Sein Genre nennt er Kunstcomedy. Entsprechend locker liest sich sein Buch – benannt nach dem ARD-TV-Format „Ich sehe was, was du nicht siehst“.
Apropos da Vinci: Im ersten der zehn Ausstellungsräume – wie die Kapitel benannt sind – geht es um Mona Lisa. Da lernt man gleich Fachbegriffe wie die in der Hochrenaissance typische Maltechnik Sfumato (um ihre Mundwinkel) und erfährt Fun Facts wie jenen, dass sie keine Augenbrauen hat.
Was ist eine Petersburger Hängung? Was unterscheidet Skulptur von Plastik? Seit wann tragen Kunstwerke Titel? Schwerdtfegers klares Ziel, das Image der bildenden Kunst (verstaubt, elitär, verkopft) zu retten und aus den „heiligen Hallen“ zu holen, kann man ihm nicht absprechen. Das vermittelt er glaubhaft, abwechslungsreich und für jeden verständlich. Er erklärt Begriffe wie „kuratieren“, „Schaudepot“ und „White Cube“. Ohnehin Interessierte fühlen sich nicht immer angesprochen. Ihnen würde es nicht schwer fallen, fünf berühmte Künstlerinnen zu nennen. Doch für sie hat der Autor einen weiterführenden Buchtipp parat: „The Story of Art Without Men“.
Er entkräftet den Mythos vom wahnsinnigen Genie van Gogh. Er berichtet, wie zehn Ecstasy-Pillen als „Zufallskauf im Darknet“ (so heißt die Aktion) in die Kunsthalle St. Gallen gelangten. Und beantwortet eine öfter gestellte Frage: Womit verdient Banksy sein Geld? Thematisiert wird sogar der Geruch von Monetärem. Die Schweizer Künstlerin Katharina Hohmann hat einen Duft aus Feigenblättern, Wildleder und Cannabis nachgebaut und die kleinen Flakons im Finanzamt verkauft.
Schwertdtfeger weiß, dass man Informationen in Häppchen serviert. Deshalb erstellt er eine Liste an Werken, die aus Versehen zerstört wurden, eine Aufzählung spektakulärer Kunstdiebstähle und ein Glossar zum Eindruckschinden. Der Autor pflegt eine Vorliebe für Wortspiele wie „Galeriegeschwätz“ und „haariges Highlight“ (gemeint ist Salvador Dalís Bart).
Der Tonfall ist aufgedreht, ja fast marktschreierisch, was mal ansteckend, mal anstrengend wirkt. Die bemüht witzigen Vergleiche mögen auf der Kabarettbühne funktionieren, im Buch sind Aussagen wie „Dieser Satz hat fast so viel Pathos wie Braveheart, aber er stimmt“ eher enervierend. Und dass ein Gemälde so groß ist wie 140 Pizzakartons oder „39.000 dieser viereckigen Kaubonbons in Silberpapier“, hilft nur bedingt dabei, sich 3,6 x 4,4 Meter vorzustellen.
Schade, dass er zwar die Abbildungsnachweise für mehr als 70 Bilder selbstverständlich angibt, aber Quellen nur für direkte Zitate nennt. Wo erfährt man beispielsweise, dass Leonardo da Vinci einer Eidechse Flügel, Hörner und einen Bart aufgeklebt hat, um seine Freunde zu erschrecken?
Das Buch vermittelt die Erzählungen und auch das Provokationspotenzial hinter vielen Werken. Hinter dem Müll, der zum Schattenbild aufgetürmt ist, hinter Fäkalien in der Dose und dem toten Tigerhai im Schwimmbecken. Es versammelt erstaunlich viele Beispiele an unsichtbarer Kunst, von Yves Klein, der den Himmel zu seinem Werk erklärte, bis zu Yoko Ono, die mit Luft gefüllte Kapseln verkaufte. Kunst ist, wo alle hinschauen. Mit diesem Buch sieht man je nach Vorwissen auf jeden Fall ein bisschen mehr.