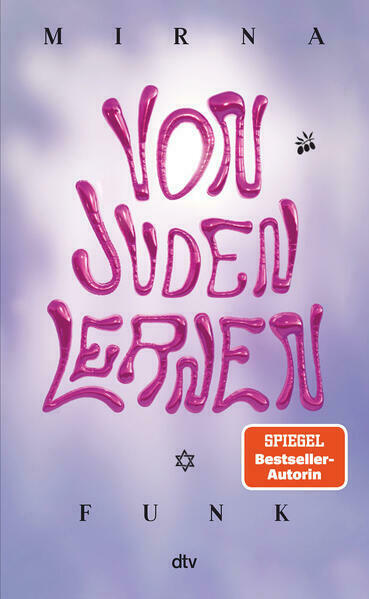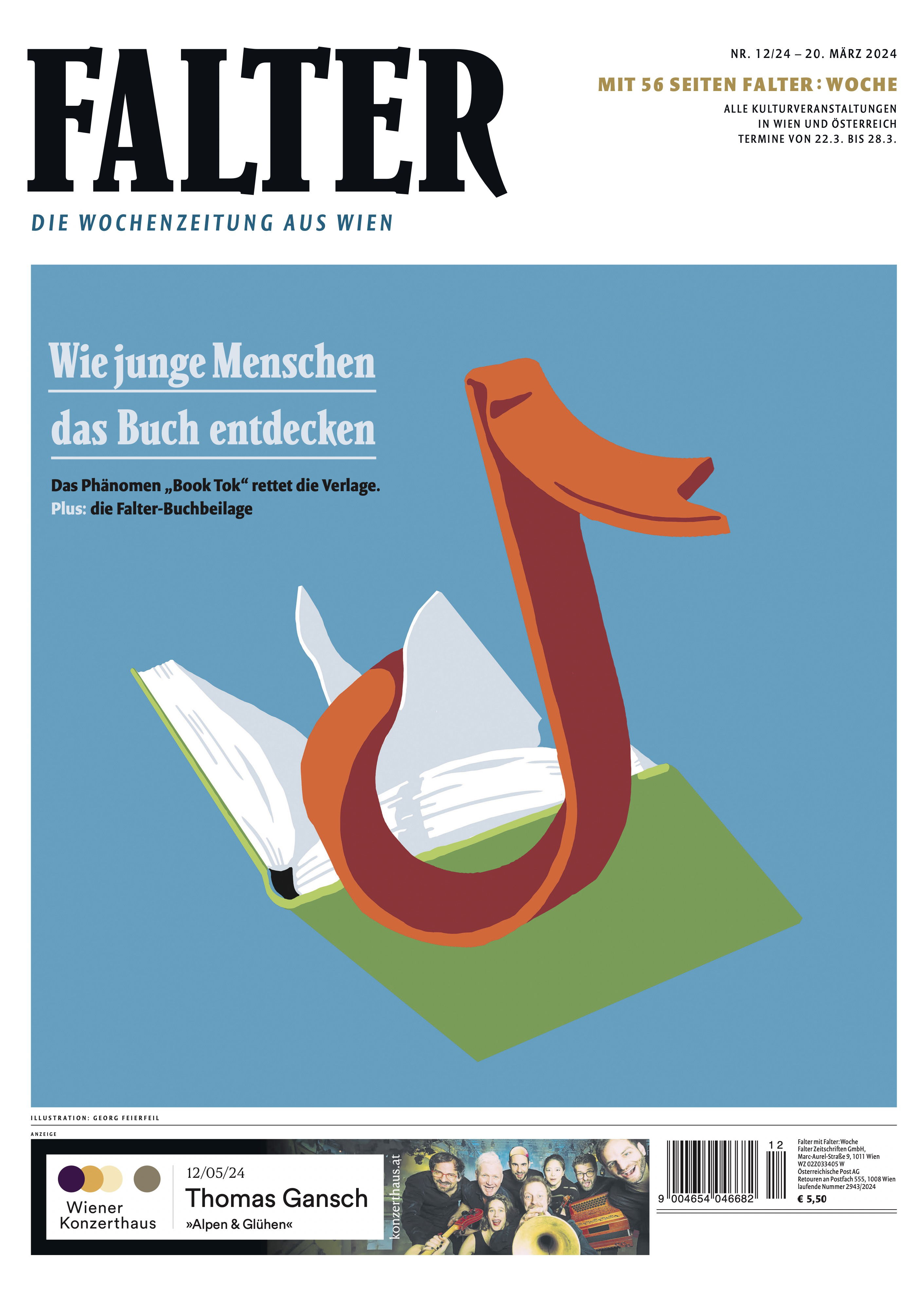
Wenn sich zwei streiten
Anna Goldenberg in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 28)
Mirna Funk streitet viel. Ob Nahostkonflikt, Sexualität oder Sozialstaat – die deutsch-jüdische Autorin und Journalistin hat jede Menge Meinungen und eckt oft an. Warum macht ihr der Streit solchen Spaß?
In ihrem Buch „Von Juden lernen“ erklärt sich die 43-Jährige nun selbst. Nach zwei Romanen, einem Sachbuch über Feminismus und einem Kinderbuch ist es ihr fünftes Buch. Acht Theorien der jüdischen Ideengeschichte arbeitet sie darin auf und stellt einen Bezug zur Gegenwart her. Oder genau genommen: zu ihrer Gegenwart.
Mit intimen Anekdoten, um die Theorien verständlicher zu machen, geizt Funk nämlich nicht. Wenn sie die Rolle von Sexualität erklärt, die im Judentum anders als im Christentum nicht als von Sünde behaftet gesehen wird, sondern als wichtiger Bestandteil einer guten Beziehung, erfährt man auch von einer ihrer Onlinedating-Bekanntschaften: Der Mann, ebenfalls Jude, hatte eine Rückenpartie, so muskulös, wie sie „normalerweise nur Olympiaschwimmer haben“, und geht nach einer beinah schlaflosen Liebesnacht („während er an meinem Nacken herumknabberte, verlor ich zeitweise das Bewusstsein“) im Handstand durch die Wohnung.
Man erfährt, dass der Mann im Judentum die Pflicht hat, die Frau sexuell zu befriedigen. In der Bibel wird das hebräische Wort für (er)kennen, „yada“, auch für den Sexualakt verwendet – es geht also um den Dialog. „Niemand kann wissen, welche Fantasien und Bedürfnisse ich habe“, schreibt Funk: „Ich muss diese kommunizieren.“
Funks Plauderton klingt zwar streckenweise etwas berufsjugendlich (da wird zum „Dinner“ geladen, „Money“ benötigt, der Wasserdruck als „nicht bombe“ kritisiert), liest sich aber zügig. Neben der Theologie von nackenknabbernden Sexmaschinen erklärt Funk das Prinzip von „Tikkum Olam“, dem Verbessern der Welt, ebenso wie die Rolle der Frau. Geschickt stellt die studierte Philosophin dabei den Bezug zur westlichen Ideengeschichte von Hegel bis Kant her, ohne besserwisserisch daherzukommen.
Sie führt aus, warum die üble Nachrede im Judentum verpönt ist; als Anschauungsbeispiel dienen Online-Shitstorms, deren Zielscheibe sie gelegentlich wird. Zuletzt geschah das in den Wochen nach den Anschlägen vom 7. Oktober: Versorgt sie auf Instagram ihre 42.000 Follower normalerweise mit einer unterhaltsamen Mischung aus jüdisch-deutschen Debattenbeiträgen, Bikinifotos, Nagellackwerbung und israelischen Nachrichten, so postete sie nun vermehrt über Antisemitismus und ihre Unterstützung für die israelische Armee.
Weil Funk nur einen jüdischen Vater hat, gilt sie nach religiösen Gesetzen nicht als Jüdin – und führte deshalb im September 2021 die sogenannte Statusanerkennung durch, also den Übertritt zum Judentum. Dabei beschäftigte sie sich intensiver mit jüdischen Ideen. „Dieses Buch ist Teil meiner Reise“, schreibt sie. Und das spürt man – vor allem dann, wenn ihre Schlussfolgerungen nicht ganz nachvollziehbar sind.
Im Kapitel über „Zedaka“, das sich als „Gerechtigkeit“ oder „Wohltätigkeit“ übersetzen lässt, erklärt Funk, die höchste Stufe der Wohltätigkeit sei die Hilfe zur Selbsthilfe, kurz: Bildung statt Almosen. So weit, so verständlich. Als Negativbeispiel nennt sie allerdings die österreichische Millionenerbin Marlene Engelhorn, die sich nur über ihr Erbe „beschweren“ würde, „anstatt in der gesamten Republik Privatschulen für Kinder aus prekären Verhältnissen zu eröffnen“. Allerdings setzt sich Engelhorn für eine höhere Besteuerung von Vermögen ein: Hilft das nicht auch dem Schulwesen?
Vielleicht lässt die Autorin hier ja absichtlich eine Lücke. Man bekommt nämlich Lust, mit ihr zu diskutieren. Gegen Ende erklärt sie, wie der Streit („machloket“) richtig geht: Wichtig sei das „Aushalten gegensätzlicher Positionen“ und das Ende von Dichotomien sowie der „Obsession, immer und überall moralisch überlegen sein zu wollen“.
Das klingt nach einem Streit, der Spaß macht