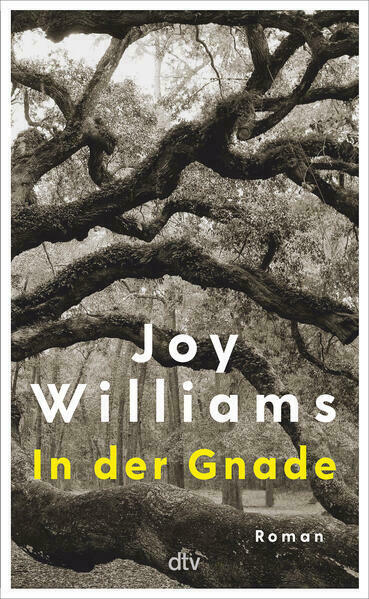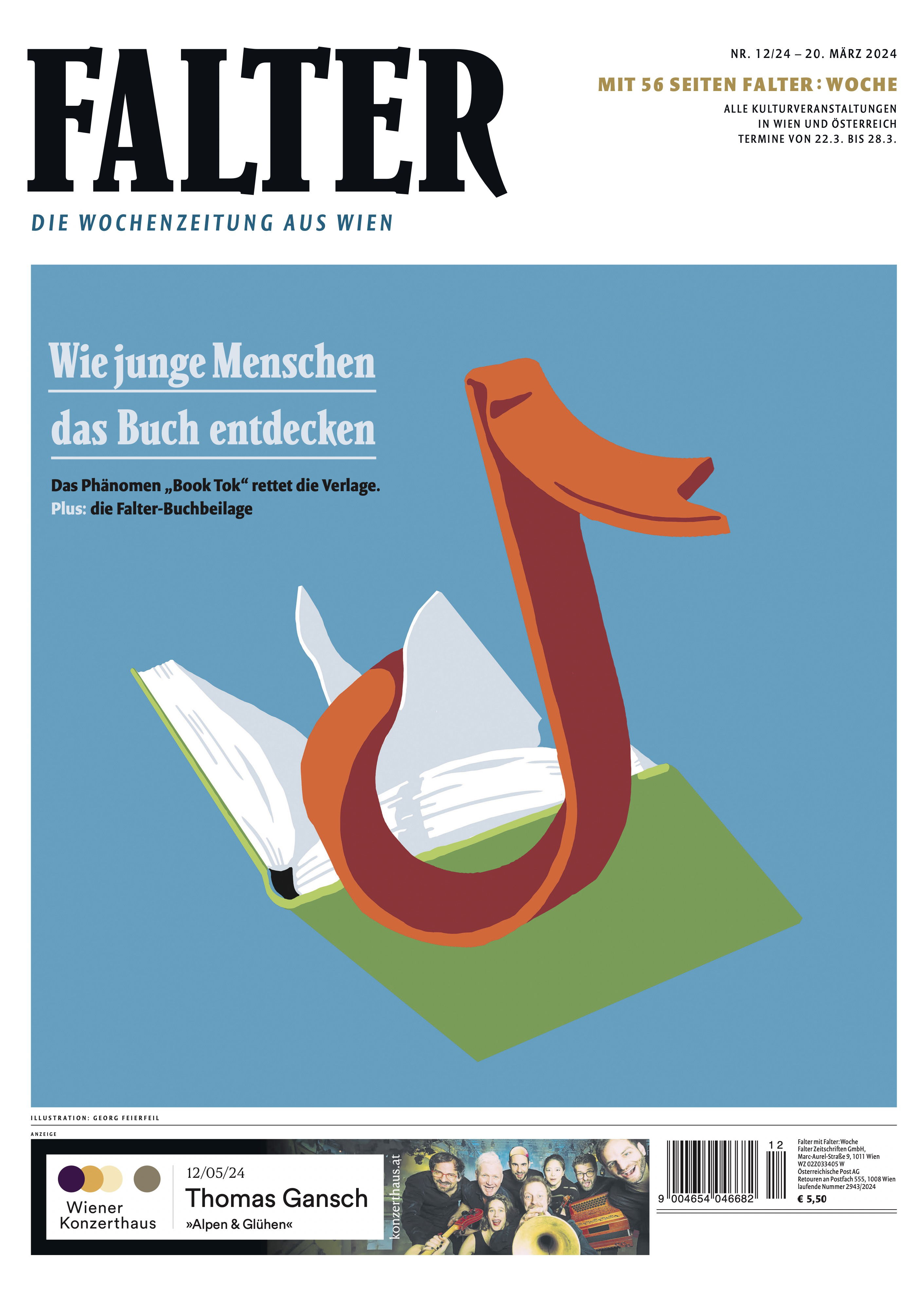
Kein Entkommen für Kate
Tobias Heyl in FALTER 12/2024 vom 22.03.2024 (S. 17)
Die Schriftstellerin Joy Williams musste fast 80 Jahre alt werden, bis ihre Bücher ins Deutsche übersetzt wurden. Dabei gilt sie in den USA schon lange als hochbedeutende Autorin und kann mit den besten Referenzen aufwarten: Raymond Carver, Lauren Groff, Bret Easton Ellis und Don DeLillo zählten zu ihren bekennenden Fans.
Im vergangenen Jahr war es dann endlich soweit, dass ein Band mit „Stories“ aus den Jahren zwischen 1972 und 2004 eine erste Vorstellung vermittelte, welch bedeutendes Werk hier zu entdecken ist. Ihre frühen Geschichten zeigen Verwandtschaft mit Carver oder Richard Yates (mit beiden hat sie in Iowa studiert), mit der Zeit aber hat sie sich von allen Konventionen realistischen Erzählens freigeschrieben.
Da stromert eine Horde Kinder eine ganze Nacht lang durch einen Zug, der wie eine fantastische Stadt eingerichtet ist, die Mütter verurteilter Mörder schließen sich zu einem Verein zusammen und ein seltsames Pärchen wuchtet einen verrosteten Oldtimer ins Wohnzimmer, nur weil da gerade noch Platz ist. Und immer wieder wird ordentlich getrunken, was den Abschied von der Wirklichkeit beschleunigt.
Vermischen sich da Traumbilder mit der Wirklichkeit? Die Grenzen zwischen der Innen- und Außenwelt der Figuren jedenfalls werden porös. Die surrealen Bildlandschaften, die sich nun entfalten, könnten auch die Seelenwelten der Figuren sein. Oft ist das eine morbide Gegend mit verfallenen Häusern, bevölkert von Menschen, deren Leben sich in einer unaufhaltsamen Abwärtsspirale bewegen. Und schon in den frühen Erzählungen geht es um die Zerstörung der Natur, für Joy Williams ein Lebensthema.
Nach ihrem Studium zog sie nach Florida, wo sie noch heute lebt. Auf den meisten Fotos, die von ihr kursieren, hat sie ihre Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen. In Fragen der Kommunikation gilt sie als eigenwillig, einen E-Mail-Account hält sie, so wird erzählt, für verzichtbar.
Ihr Werk umfasst neben Erzählungen und Essays bis dato fünf Romane. Der älteste, „State of Grace“ aus dem Jahr 1973, ist nun als „In der Gnade“ auf Deutsch erschienen. Das klingt nach religiöser Erbauung. Und tatsächlich wurde Kate, die Hauptfigur, in eine evangelikale Familie hineingeboren.
Der Vater ist ein Prediger, man erfährt nie so recht, welcher Kirche er angehört, vielleicht verkündet er die frohe Botschaft auch als One-Man-Show. Groß kann seine Zuhörerschaft nicht sein, denn er lebt auf einer kleinen Insel vor der Küste Neuenglands. Von der Familie ist nicht mehr viel übrig, die Schwester ist bei einem Unfall ums Leben gekommen, die Mutter stirbt mit einem ungeborenen Kind.
Kate ist ihrem Vater ausgeliefert, der sie mit alttestamentarischer Strenge erzieht, die er als Liebe deklariert. Heute hätte sich aus dieser Konstellation vermutlich eine Missbrauchsgeschichte entwickelt.
Dass Williams über Andeutungen nicht hinausgeht, hat eher nichts mit Tabus vergangener Zeiten zu tun: Gerade das Zweideutige, Unscharfe macht ihre erzählerische Kunst aus.
Kate flieht weit weg, ins sonnige Florida. Sie kellnert, hat gleichgültigen Sex, besucht ein College und findet Unterschlupf in einem Haus, von dem nie so recht klar wird, ob das nun ein Kloster ist oder ein Wohnheim für Studentinnen. Irgendwann zieht sie zu Grady, der in einem heruntergekommenen Wohnwagen lebt, mitten in der Natur, nicht weit vom Meer.
Es ist heiß, die Luft feucht, überall wuchert üppige Vegetation. Die Welt kann also auch ein Paradies sein. Die beiden verbindet eine tiefe, glückliche Liebe. Kate wird schwanger, sie heiraten – und Grady kommt bei einem Autounfall ums Leben. Mit ihrem Baby kehrt sie zurück zu ihrem Vater nach Neuengland. Es gibt eben kein Entkommen.
So schlicht von der ersten bis zur letzten Katastrophe erzählt Williams Kates Leben aber gerade nicht. Vielmehr setzt sie deren Biografie aus vielen Einzelszenen zusammen, die nur grob einer Chronologie folgen. Erzählerisches Zentrum ist Gradys Wohnwagen, dort erinnert sie sich an ihre Kindheit und die Flucht nach Florida. Immer wieder wechselt die Erzählperspektive. Bibelzitate gemahnen Kate auch in der Ferne an ihre Herkunft.
Man kann sich diese Erzählweise als eine Mischung aus Erinnern und Träumen vorstellen, als ein kunstvoll ungeordnetes Arrangement von Episoden und Bildern. An den stärksten Stellen des Romans, der sonst eher nicht zu identifikatorischer Lektüre einlädt, glaubt man sich in Kate hineinversetzt, zutiefst vertraut mit ihren Gefühlen und Ängsten.
Solche Distanzlosigkeit wirkt beklemmend genug. Williams steigert diesen Effekt noch einmal, wenn sie sehr direkt und drastisch Schmutz, Körpersekrete und alle möglichen Formen des Verfalls vors innere Auge führt.
Das mögen mache Leser als Zumutung empfinden. Williams schont sich aber auch selbst nicht. Denn Kates Leben ist gar nicht so weit von ihrem eigenen entfernt. Sie wuchs in einer Kleinstadt in Massachusetts als Einzelkind auf, ihr Vater war Prediger. Auch ihr wurde Florida zum Zufluchtsort, hier begann sie zu schreiben.
Könnte gut sein, dass die Autorin am Beginn ihrer Karriere mit diesem Buch sich selbst erforscht hat. Am Ende ist ihre Geschichte glücklicher verlaufen als die ihrer Hauptfigur. Wahrscheinlich war es für Williams überlebenswichtig, der Enge eines evangelikalen Elternhauses zu entkommen.
Kate ist das nicht gelungen. Ihr Vater hat es sicher der Gnade Gottes zugeschrieben, dass seine verlorene Tochter wieder nachhause zurückgekehrt ist. Kate mag Gnade anders verstehen: als ein Leben, das sie nicht frei, sondern nur abhängig von der Gnade anderer führen kann.