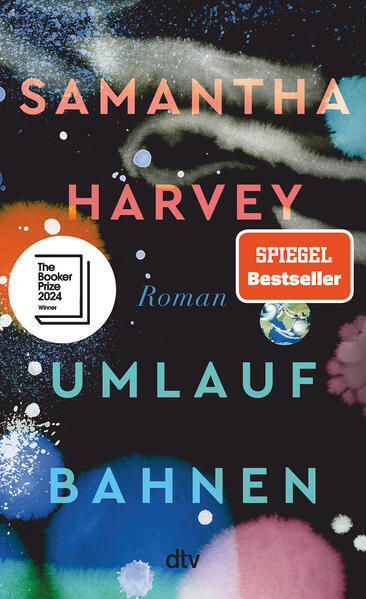Lob des geozentrischen Weltbilds
Klaus Nüchtern in FALTER 51-52/2024 vom 20.12.2024 (S. 47)
Treffen sich zwei Planeten. "Ich hab Homo sapiens", erklärt der eine sein kränkliches Aussehen, worauf der andere antwortet: "Hatte ich auch schon, geht aber schnell vorbei."
Im finsteren Zeitalter des Anthropozäns ist Gattungskritik angesagt: als Witz, als Predigt, als Selbstbezichtigungssuada. All das leistet auch Samantha Harveys Roman "Umlaufbahnen", bloß Witze sind rar gesät. Eigentlich gibt es nur eine Stelle, die einen schmunzeln lässt: Die Türen der Toiletten in der Raumstation, auf der die Autorin ihr Personal untergebracht hat, sind mit "Nur für russische Kosmonauten" beziehungsweise "Nur für amerikanische, europäische und japanische Astronauten" beschriftet. Ansonsten lautet die Devise an Bord vor allem: "Diskretion." Ein paar Informationen über das Privatleben der vier Männer und zwei Frauen werden dennoch bereitgestellt.
Am meisten erfahren wir über Chie, die gar nicht auf der Welt wäre, hätte deren Mutter den Atombombenabwurf über Nagasaki nicht durch einen Zufall überlebt. Nun ist sie tatsächlich gestorben und Chie bleibt ein Foto, das sie bei sich an Bord hat. Es wurde am Tag der ersten bemannten Mondlandung aufgenommen und zeigt ihre Mutter als junge Frau, deren finsteren Blicken gen Himmel die Tochter eine Botschaft an sich zu entnehmen sucht.
Es wird überhaupt viel geschaut in diesem Roman, für den Harvey zeitgleich mit dem Erscheinen der deutschen Übersetzung den Booker Prize 2024 erhielt. Shaun etwa denkt seit Jahren über das Sujet von Velasquez' berühmtem Gemälde "Die Hoffräulein" und darüber nach, wer hier eigentlich auf wen blickt. Vor allem aber sind alle gebannt vom Schauspiel, das sich unmittelbar vor den Fenstern der Station abspielt: "Mitunter sehen sie die Erde an und sind versucht, [] zu glauben, dass dieser Planet im Zentrum von allem steht. Er wirkt so spektakulär, so ehrwürdig und majestätisch."
"Der Weltraum ist die einzige Wildnis, die uns noch bleibt", heißt es an einer Stelle. Aber während Transhumanisten von der Eroberung und Kolonialisierung des Alls träumen, mobilisiert "Umlaufbahnen" ein One-World-Ethos: Es gibt keinen Planet B, und es gibt nur eine Menschheit. Wie deren Zukunft aussehen wird, mag in den Sternen stehen, hängt aber tatsächlich von den Ozeanströmen, den brennenden Regenwäldern oder dem sich zusammenbrauenden Monster-Taifun ab, der sich von der Raumstation aus beobachten lässt. Seine zerstörerischen Auswirkungen auf den Philippinen werden hautnah geschildert, wenn der Roman für einen kurzen Moment 400 Kilometer Richtung Erde zoomt.
Die cinematografische Choreografie, die den Reiz von "Umlaufbahnen" ausmacht, wird freilich von den vorbeiziehenden Wetterfronten, Gebirgsketten und Inselgruppen bestimmt, deren Bewegung den Rhythmus der Sätze selbst affiziert.
Die Virtuosität, mit der Harvey all dies zu erzählen weiß, ist fraglos beeindruckend - auch in der makellosen Übersetzung durch die Schriftstellerin Julia Wolf. Es ist freilich eine Frage des Gemüts und des Geschmacks, ob man die Meteoritenschauer an Metaphern und Vergleichen, die über die Leserschaft herniedergehen, auf Dauer erträgt. Der Atlantik ist "vom sanften Silbergrau einer ausgegrabenen Brosche", der Nil hingegen "wie verschüttete königsblaue Tinte"; die Städte Australiens liegen "im feinen Brokat" unweit der "wie von Hand gewobenen Spitze Neuseelands". Und die Erde selbst "mit ihren dick bestickten urbanen Teppichen"? Na, allemal "ein großer Brocken Turmalin, nein, eine Zuckermelone, ein Auge, eine lila, weiße, magenta, orange-mandel-mauvefarbene, zerbeulte, reliefreiche Pracht".
Der Amazon-Algorithmus würde es vielleicht so ausdrücken: Fans des Spätwerks von Filmregisseur Terrence Malick haben auch diesen Roman gekauft.