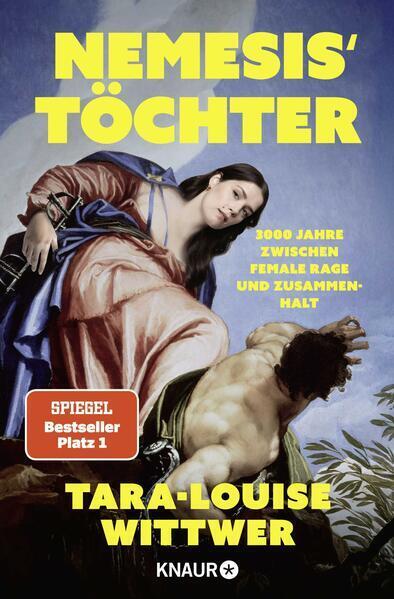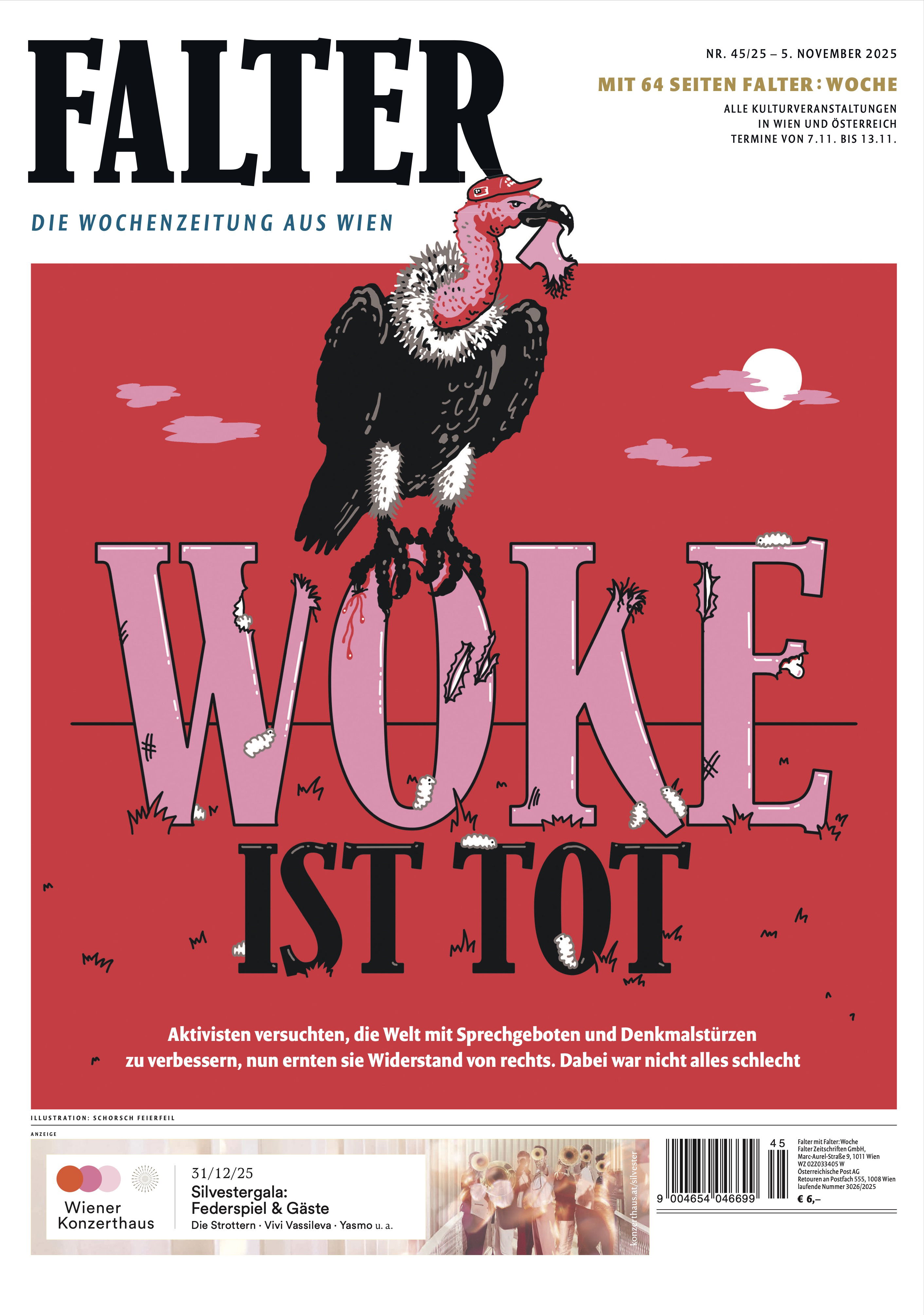
"Mein Ziel ist nicht mehr, von Männern geliebt zu werden"
Gerlinde Pölsler in FALTER 45/2025 vom 05.11.2025 (S. 20)
In einem ihrer Videos spricht die deutsche Autorin Tara-Louise Wittwer über ihre Wut. Danach, schreibt sie, seien die Kommentare nur so auf sie eingeprasselt: "Guck mal, wie unsympathisch sie ist Also, sie hat schon recht damit, dass Femizide ein schlimmes Thema sind und so, aber könnte sie bei der Bitte, dass Männer weniger Frauen ermorden, vielleicht netter gucken?" Wütende Frauen bekämen aber auch eigene Threads "gewidmet" mit Titeln wie: "Hässliche Instagram Fotze."
Schon sind wir beim Thema von Wittwers neuem Buch: der Wut und den Reaktionen, mit denen Frauen rechnen müssen, wenn sie es wagen, sie zu zeigen. Wittwer, 35, zählt unter @wastarasagt, ihrem Usernamen auf Tiktok, und Instagram zusammen mehr als eine Million Follower. Sie ist auch Spiegel-Kolumnistin, und ihr Buch "Sorry, aber Eine Verzichtserklärung an das ständige Entschuldigen" wurde im Vorjahr zum Bestseller. In "Nemesis' Töchter" rekapituliert sie nun, wie Frauen 3000 Jahre lang unterdrückt wurden, ihre Wut darüber aber nicht ausdrücken durften und oft nicht einmal spürten. Dabei, schreibt Wittwer, "ist Wut so ein heilsames Gefühl".
Zu Beginn fasst die Kulturwissenschaftlerin zusammen, wie sich die Abwertung von Frauen und deren Wut durch die Geschichte zieht. Schuf die titelgebende Göttin Nemesis in der griechischen Antike gerechten Ausgleich, so mehrten sich im Römischen Reich Darstellungen mit Schwertern und Peitschen. Das zeige die Tendenz, "weibliche Gerechtigkeitsinstanzen zu emotionalisieren und in Richtung Vergeltung umzucodieren". Auf ihrem Ritt durch die Zeit gelingen Wittwer einige sehr treffende Analysen. So fragt sie, warum zur Hölle wir immer noch von Hexenverfolgung reden - ohne Anführungszeichen -, als seien hier tatsächlich Hexen verfolgt worden und nicht (größtenteils) Frauen gefoltert, gevierteilt, ertränkt und verbrannt.
Wut allerdings hätten Frauen immer ignoriert, geschluckt, weggelächelt, denn: Wut zeigen zu können ist ein Privileg. "Wer beim Ausdruck seiner Wut keine Unterdrückung oder Bestrafung fürchten muss, hat Macht " Nun aber, findet Wittwer, sei die Zeit gekommen für "female rage", für weibliche Wut: Die sieht sie nicht nur als Reaktion auf ein einzelnes Unrecht, sondern auf das Unrecht, das die Hälfte der Gesellschaft betrifft und das diese nicht mehr hinzunehmen bereit ist. Diesen rage sieht sie auch als politische Ressource: Hätten die Suffragetten nett gefragt, ob sie vielleicht auch einmal wählen dürften, hätten sie nie das Frauenwahlrecht durchgesetzt.
Stellenweise ist der Tonfall im Buch recht plauderig; manche Stellen hätten Kürzungen vertragen, andere gern ausführlicher ausfallen können. Eine Stärke liegt darin, wie Wittwer sich selbst der Analyse unterwirft: Auch auf ihr habe schwer "das Narrativ der hässlichen, anstrengenden, lauten Frau" gelastet. Also lächelte sie, weinte vor Wut, konnte sie aber nicht ausdrücken. Damit sei nun Schluss.
Doch es gibt noch etwas, das Wittwer verändert hat und zu dem sie rät: Frauensolidarität. Das mag wenig revolutionär klingen, ist aber sehr wohl aktuell in einem Wirtschaftsmodell, das ständiges Konkurrenzverhalten fordert, oder einem Pop-Business, das Frauen gegeneinander ausspielt. Und sie ortet Zeichen dafür, dass immer mehr Frauen sich solidarisieren: In einem Video erzählte eine Frau, ihr Ex habe Unterwäschebilder von ihr in Umlauf gebracht. Wittwer rechnete mit einer Flut an "Selber schuld"-Kommentaren, fand aber weibliche Bestärkungen. Und postuliert: "Frauen, die zusammenhalten, verändern die Welt."